Warum das Steuersystem einfacher werden sollte
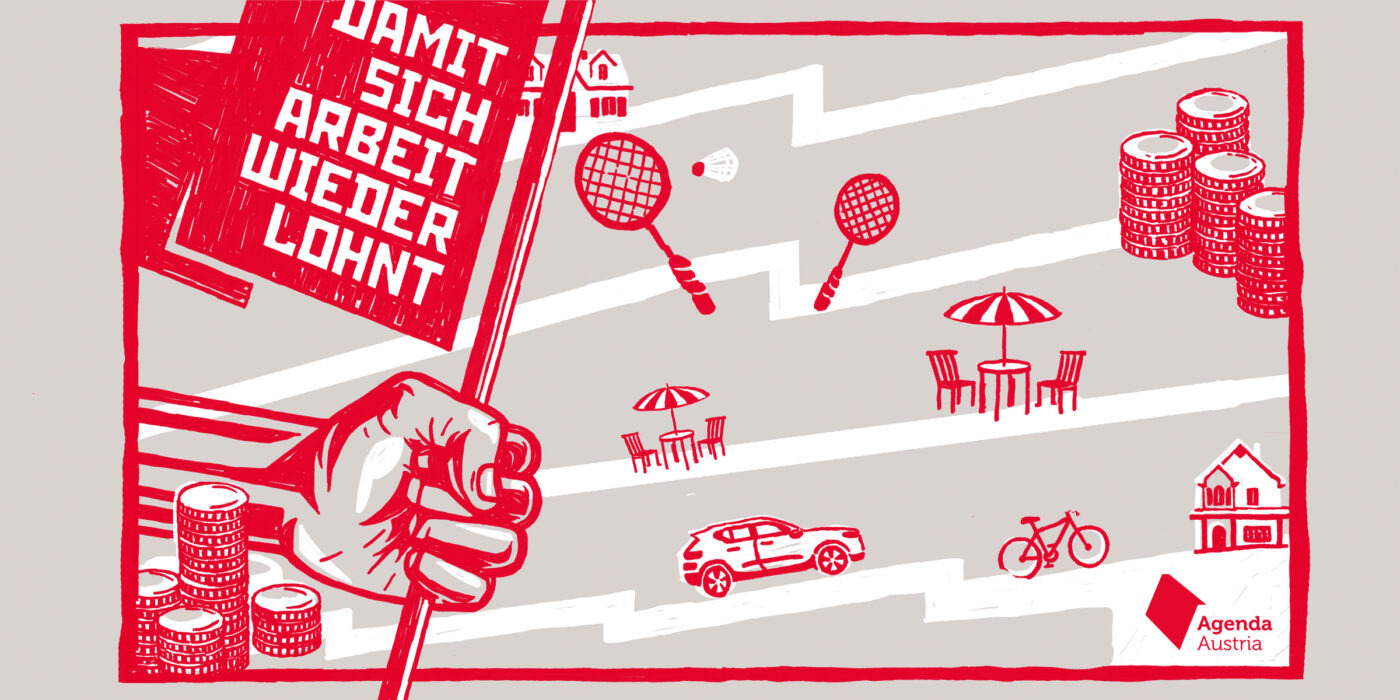
- 04.04.2019
- Lesezeit ca. 2 min
Einfach, transparent und leistungsfreundlich!
Weniger ist mehr. In Österreichs Steuersystem wird allerlei Verhalten gefördert, subventioniert und begünstigt. Das Einkommensteuergesetz 1988 wurde in den vergangenen 30 Jahren mehr als 160 Mal novelliert.
In den meisten Fällen wurde das Gesetz damit nicht vereinfacht, sondern es wurden neue Ausnahmen und Sonderregelungen eingeführt. Gerne heißt es ja: Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht des Steuerzahlens. Die Kenntnis aber häufig. Diesem Leitmotiv folgend ist das österreichische Steuersystem äußerst komplex. Es kennt hunderte Sonderregelungen und Ausnahmen, Frei- und Absetzbeträge. Die Steuerreformkommission hat 2014 errechnet, dass die Ausnahmetatbestände ein Volumen in der Höhe von insgesamt 15 Milliarden Euro ausmachen.
Seit Jahren kritisiert der Rechnungshof[1], dass die Wirkung und das Aufkommen aller Steuerbegünstigungen und Ausnahmen nicht ausreichend untersucht werden, geschweige denn, in der Vergangenheit erfasst wurden. An dieser Feststellung hat sich wenig geändert. Die mehr als 700 Ausnahmen wirken zum Teil gegeneinander oder fördern dasselbe. Doppel- und Mehrfachförderungen sind die Regel, nicht die Ausnahme.
Beispiel Pendlerförderung: Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an Fördermaßnahmen für das Pendeln. Neben der Pendlerpauschale, die rund 780 Millionen Euro kostet, gibt es noch den Verkehrsabsetzbetrag, der jedem Arbeitnehmer zugutekommt, mit einem Aufkommen von mehr als 800 Millionen Euro. Dazu kommt noch der 2013 eingeführte Pendlereuro, der sich anhand der zurückgelegten Wegstrecke berechnet und rund 60 Millionen Euro kostet.
Das Jobticket fördert Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern ein Ticket für den öffentlichen Verkehr an die Arbeitsstätte bezahlen, mit Gesamtkosten von 50 Millionen Euro. Für Geringverdiener gibt es noch den erhöhten Verkehrsabsetzbetrag.
Und daneben haben auch noch die Bundesländer eigene Förderprogramme aufgelegt, die auch noch einmal mehrere hundert Euro pro Pendler ausschütten können.
Summa summarum wird die Fahrt der Arbeitnehmer und Arbeiter zu ihren jeweiligen Arbeitsstätten intensiv finanziell unterstützt. Die Wirkungen dieser Förderungen und das gesamte Aufkommen werden nicht systematisch erfasst. Vorschläge zur Vereinfachung der Förderinstrumente verhallten bis dato ungehört – im Gegenteil: In der jüngeren Vergangenheit wurden noch weitere Förderinstrumente geschaffen. Das Beispiel der Pendlerförderung zeigt, dass die Ausnahmen im österreichischen Steuerrecht zwar mannigfaltig sind, aber nicht zielgerichtet und schon gar nicht aufeinander abgestimmt. Wenn die Regierung es ernst meint, das „Einkommensteuergesetz in den Mistkübel zu werfen“,[2] dann sollte es nach Analyse der Agenda Austria möglich sein, rund zehn der insgesamt 15 Milliarden Euro an Ausnahmen abzuschaffen und in den allgemeinen Tarif zu integrieren. Der größte Brocken wäre freilich das steuerbegünstigte Jahressechstel.
Fußnoten
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





