Gazellen und Einhörner braucht das Land!
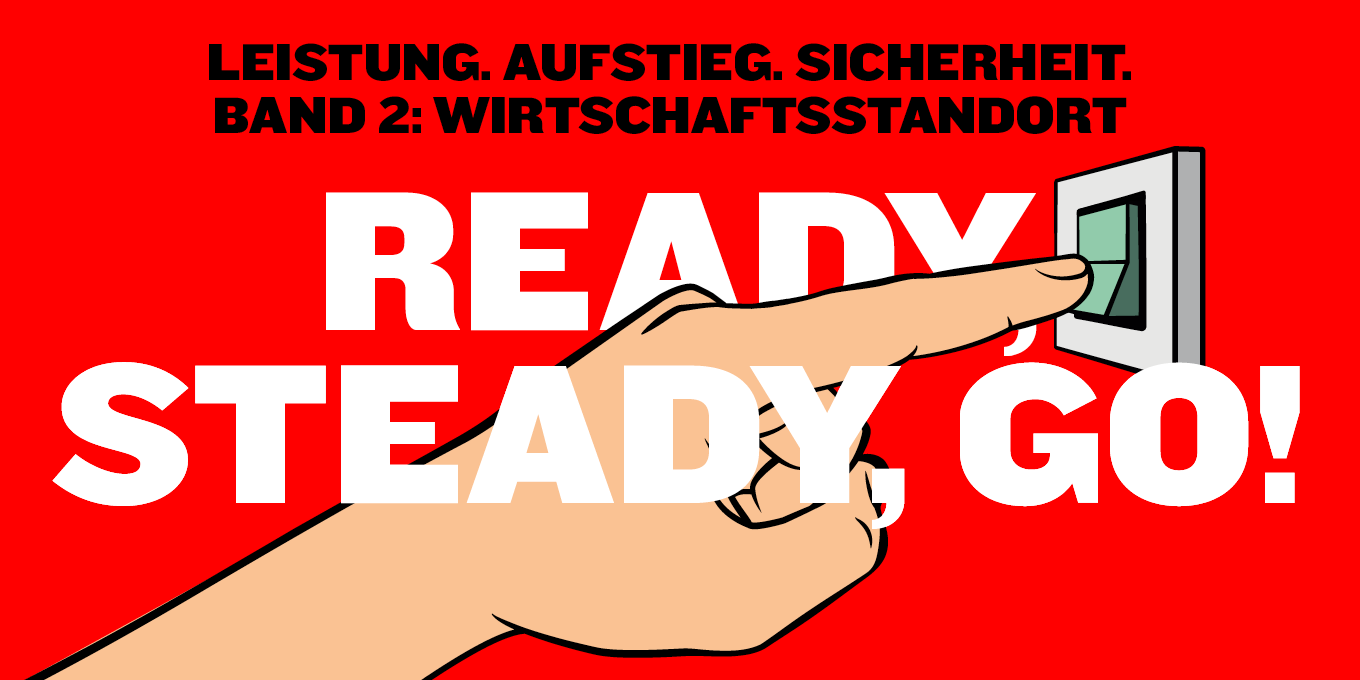
- 17.09.2019
- Lesezeit ca. 2 min
LEISTUNG. AUFSTIEG. SICHERHEIT.
Die Digitalisierung schafft beste Voraussetzungen für einen neuen Gründerboom. Dazu müssen aber noch einige Hürden aus dem Weg geräumt werden.
Kinder sind die Zukunft, lautet ein Satz, den jeder Politiker auswendig gelernt hat. Doch was für die Bevölkerungsdemografie gilt, gilt abgewandelt auch in der „Unternehmensdemografie“. Die Geburtenrate neuer Unternehmen ist eine zentrale Kennzahl, um die Dynamik und die Zukunftsperspektive eines Wirtschaftsstandorts einschätzen zu können. Im Jahr 2012 schuf in Österreich beispielsweise jedes neue Unternehmen ab dem ersten Jahr durchschnittlich 2,4 neue Arbeitsplätze.[1]
Österreich braucht mehr Dynamik
Doch die Rate der neu gegründeten Unternehmen ist hierzulande eher niedrig. Im EU-Vergleich zählt Österreich zu den drei gründungsschwächsten Ländern, nur in Belgien und Griechenland wird noch seltener der Schritt ins Unternehmertum gewagt.[2]Auf 100 bestehende Unternehmen kamen im Jahr 2016 in Österreich nur rund sieben neue, in der EU waren es immerhin zehn, im Vereinigten Königreich 15. Was allerdings noch bedenklicher für den Wirtschaftsstandort ist: Auch bei den „Gazellen“, den wirklich schnell wachsenden Unternehmen, die auch für die meisten neuen Jobs sorgen, wird Österreich von dynamischeren Volkswirtschaften weit abgehängt.[3]Es wird also selten und vor allem zu wenig auf Wachstum ausgerichtet gegründet.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen 'Abb. 13: In Österreich sind nur wenige Menschen in wachstumsstarken Unternehmen beschäftigt.
Warum das so ist, darauf gibt die jährlich erscheinende Studie zum „Ease of Doing Business“ der Weltbank ein paar zweckdienliche Hinweise. Dafür sammelt die US-Institution weltweit Daten darüber, wie schnell und wie unbürokratisch gegründet wird und wie hoch die regulatorischen Hürden für Unternehmen oder die Steuern und Abgaben sind. Österreich schneidet in diesem Ranking zum wiederholten Male schlecht ab, wenn es um die Neugründungen geht (Platz 118 von 190).[4]
Neue Firmen, neue Finanzen?
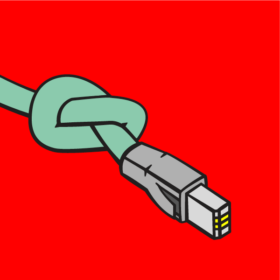 Ein enger Flaschenhals für junge Unternehmen stellt in Österreich die Finanzierung dar. Zwar haben die Politiker aller Parteien längst die „Start-up-Szene“ für sich entdeckt und überbieten sich regelmäßig mit neuen Diskussionsbeiträgen zu deren Förderung. Und so schwimmen gerade in den ersten Jahren nach der Gründung einige junge Unternehmen im öffentlichen Geld. Doch woran es wirklich scheitert, ist die Anschlussfinanzierung. Dafür fehlt es an zentralen Spielern: Fonds für Wagniskapital (Venture Capital) sowie Private Equity. Private Equity und Venture Capital Fonds sind Finanzinvestoren, die sich an Unternehmen beteiligen, sie bei ihrem Wachstum oder in einer Umstrukturierung finanzieren und danach weiterverkaufen.
Ein enger Flaschenhals für junge Unternehmen stellt in Österreich die Finanzierung dar. Zwar haben die Politiker aller Parteien längst die „Start-up-Szene“ für sich entdeckt und überbieten sich regelmäßig mit neuen Diskussionsbeiträgen zu deren Förderung. Und so schwimmen gerade in den ersten Jahren nach der Gründung einige junge Unternehmen im öffentlichen Geld. Doch woran es wirklich scheitert, ist die Anschlussfinanzierung. Dafür fehlt es an zentralen Spielern: Fonds für Wagniskapital (Venture Capital) sowie Private Equity. Private Equity und Venture Capital Fonds sind Finanzinvestoren, die sich an Unternehmen beteiligen, sie bei ihrem Wachstum oder in einer Umstrukturierung finanzieren und danach weiterverkaufen.
Während beide Spieler eine möglichst hohe Rendite für ihre Anleger anstreben, unterscheiden sie sich bei der Auswahl der zu finanzierenden Start-ups. Wagniskapitalfonds investieren besonders in junge, schnell wachsende Unternehmen in der Gründungsphase, Private Equity setzt hingegen in einer Wachstums- oder Restrukturierungsphase auch auf bereits etablierte Unternehmen, die schon einen stabilen Geldfluss ausweisen. Beide Akteure sind etwa in den USA ein wichtiger Teil des wirtschaftlichen Ökosystems, um aus Start-ups oder kleinen Unternehmen aufstrebende „Einhörner“ zu machen.[5]Diese Fonds sammeln typischerweise nicht etwa staatliches Geld ein, sondern investieren private Mittel von Sparern oder Stiftungen. In Österreich ist das anders: Hier sind sogar die „Heuschrecken“ staatlich.[6]
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen 'Abb. 14: Private Equity und Venture Capital sind Formen der Risikokapitalfinanzierung. Typischerweise gehen private Investoren hier viel Risiko mit der Möglichkeit auf hohe Renditen ein.
Stagnation statt Wachstumsfinanzierung
Der Staat als Risikokapitalgeber bringt aber mehrere Probleme mit sich, die insbesondere in der Wachstumsphase der Unternehmen (Scale-up) deutlich werden: Zum einen besteht die Gefahr, dass nach dem Gießkannenprinzip möglichst viele unterschiedliche Betriebe gefördert werden. Wichtiger wäre aber, in der Startphase jene Unternehmen zu unterstützen, die auch die Aussicht auf ein starkes Wachstum mitbringen. Zum anderen haben gerade private, internationale Risikokapitalgeber Expertise, sie können Marktstrukturen und -potenziale besser einschätzen oder die eigenen Netzwerke im In- und Ausland nutzen.
In Österreich aber ist die Unternehmensfinanzierung oft noch sehr konservativ: Bankkredite sind weiter verbreitet als Beteiligungen, der Kapitalmarkt ist chronisch unterentwickelt.
Dazu gibt es keine steuerlich wirklich attraktiven Vehikel und auch nur geringe Investitionen durch institutionelle Investoren wie Versicherungen oder Fonds. Das gesamte Investitionsvolumen von Private Equity in Österreich kann momentan kaum mit europäischen Standards mithalten und liegt auf den hinteren Rängen.[7]So wurde 2016 beispielsweise in Finnland, den Niederlanden und der Schweiz etwa zehnmal so viel in Start-ups investiert wie hierzulande, in Schweden war es sogar mehr als das 20-Fache. Einzig bei den Business Angels – wohlhabenden Einzelpersonen – hat sich in Österreich um Personen wie Hansi Hansmann ein nennenswertes Netzwerk herausgebildet.
Handlungsempfehlungen
Kapital aktivieren: Wenn jungen Unternehmen das Wagniskapital fehlt, dann dämpft das auch das Wachstum. Daher gilt es, jene Hürden zu entfernen, die institutionelle und private Anleger von Unternehmensbeteiligungen abhalten. Ein wichtiger Mobilisierungsansatz: dem Risiko stärker Rechnung tragen. Das größere Risiko des Verlusts einer Investition soll besser mit möglichen höheren Gewinnen ausgeglichen werden. Für Geldgeber wie Business Angels wäre es wichtig, dass Verluste aus Beteiligungen nicht nur im Jahr des Verlusteintrittes abgesetzt werden können, sondern auf mehrere Jahre verteilt. Daher sollte im Bereich der Risikokapitalfinanzierung eine mehrjährige Durchrechnungsperiode geschaffen werden, in der die Verluste aus Investitionen mit den Gewinnen steuerlich gegengerechnet werden können. Im Gegenzug könnte die öffentliche Hand als Investor in den Hintergrund treten. Gegenwärtig erschweren es die öffentlichen Gelder privaten Investoren gerade in frühen Phasen, in vielversprechende Start-ups zu investieren, da sie mit den Konditionen öffentlicher Anbieter oft nicht konkurrieren können.
Pensionsfonds nützen:  Die Finanzierung junger innovativer Unternehmen zählt zu den riskantesten Investitionen der Wirtschaft. Man braucht für sie einen langen Atem, kann aber damit auch hohe Renditen verdienen, wie sich etwa in den USA oder in Vereinigten Königreich zeigt. Da Banken von den Regulatoren zu deutlich konservativeren Strategien gedrängt werden, müssen andere Investoren und Partner Eigen- oder Risikokapital bereitstellen können. In diesem Zusammenhang sollte eine Liberalisierung der Anlagevorschriften für Pensionsfonds angedacht werden. Und zugleich auch eine Stärkung der betrieblichen und privaten Vorsorge, um langfristig mehr Mittel zu mobilisieren. So investiert der größte dänische Pensionsfonds ganz erheblich auch in Private Equity. Das Portfolio hat aktuell einen Wert von vier Milliarden Euro und brachte 2018 einen Ertrag von 403 Millionen Euro.[8]
Die Finanzierung junger innovativer Unternehmen zählt zu den riskantesten Investitionen der Wirtschaft. Man braucht für sie einen langen Atem, kann aber damit auch hohe Renditen verdienen, wie sich etwa in den USA oder in Vereinigten Königreich zeigt. Da Banken von den Regulatoren zu deutlich konservativeren Strategien gedrängt werden, müssen andere Investoren und Partner Eigen- oder Risikokapital bereitstellen können. In diesem Zusammenhang sollte eine Liberalisierung der Anlagevorschriften für Pensionsfonds angedacht werden. Und zugleich auch eine Stärkung der betrieblichen und privaten Vorsorge, um langfristig mehr Mittel zu mobilisieren. So investiert der größte dänische Pensionsfonds ganz erheblich auch in Private Equity. Das Portfolio hat aktuell einen Wert von vier Milliarden Euro und brachte 2018 einen Ertrag von 403 Millionen Euro.[8]
Gründen wie im 21. Jahrhundert: Firmengründungen sollten in digitaler Form ermöglicht werden. Die Einrichtung eines echten One-Stop-Shops, also einer einzigen (digitalen) Anlaufstelle für jegliche Interaktionen zwischen Unternehmen und Staat, und einer „papierlosen“ Gründung im Zuge des E-Governments nach estnischem Vorbild können den Weg in die Selbständigkeit erleichtern.[9]
Unternehmer bilden: Eine stärkere Verankerung unternehmerischer und betriebswirtschaftlicher Erziehung sowohl in Schulen wie auch an den Universitäten kann die Einstellung und Befähigung zum Unternehmertum und zum Gründen positiv beeinflussen. Damit ließen sich das soziale Stigma des Scheiterns, die Zustimmung zu einer „zweiten Chance“ und die Motivation, selbst Risiko zu übernehmen, langfristig ändern. Zusätzlich könnte dadurch der Mangel an kaufmännischen Kenntnissen behoben werden.[10]
Fußnoten
- Vgl. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (2015). ↩
- Vgl. Eurostat (2019a). ↩
- Vgl. Janger & Kügler (2018). ↩
- Vgl. Weltbank (2019a). ↩
- Unternehmen mit einem Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. ↩
- Der deutsche SPD-Politiker Franz Müntefering diffamierte Private Equity Fonds wegen ihrer Investmentstrategien als „Heuschrecken“. ↩
- Vgl. Keuschnigg & Sardadvar (2019). ↩
- Vgl. The ATP Group (2018). ↩
- Vgl. Agenda Austria (2018b). ↩
- Vgl. Keuschnigg et al. (2013). ↩
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





