Zusammenfassung
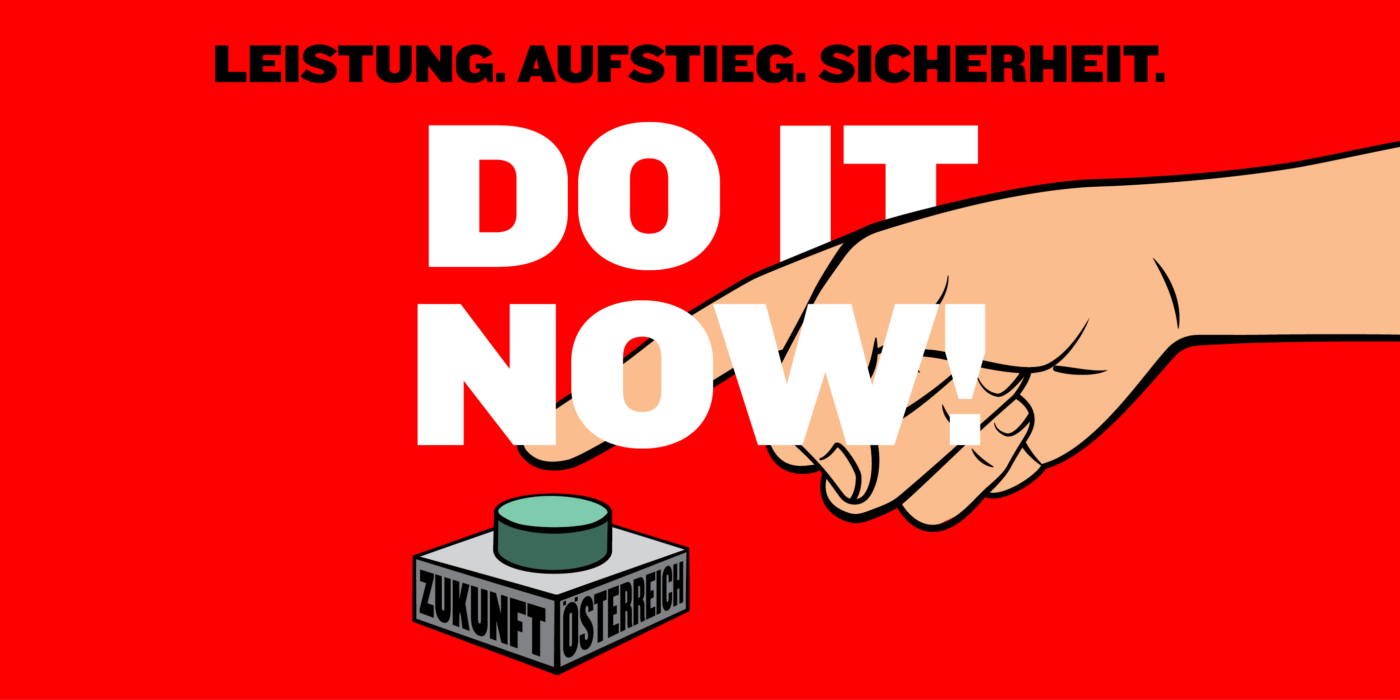
- 17.09.2019
- Lesezeit ca. 2 min
LEISTUNG. AUFSTIEG. SICHERHEIT.
Seit Jahren versprechen Politiker regelmäßig, den österreichischen Wirtschaftsstandort mit Reformen und Zukunftsinvestitionen an die internationale Spitze zu führen.
Auch die Regierung aus ÖVP und FPÖ wollte das Land nach vorne bringen. Mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit, der begonnenen Zusammenlegung der Sozialversicherungen und den Verschärfungen für den Bezug der Mindestsicherung wurden zwar erste Anpassungen vorgenommen, aber wirklich näher gekommen ist Österreich den Top Ten der weltweit wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsstandorte nicht. Das auch deshalb nicht, weil die Regierungen anderer Länder deutlich veränderungsbereiter sind als die österreichische.
Leistung.
Aufstieg.
Sicherheit.
Ins Zentrum ihrer Arbeit sollte die künftige Regierung die Konsolidierung der Staatsfinanzen rücken. Nur in vier europäischen Ländern bleibt den Arbeitnehmern netto weniger von ihrem erwirtschafteten Einkommen übrig als in Österreich. Und dank der nicht abgeschafften Inflationssteuer, der sogenannten „kalten Progression“, wird es jedes Jahr noch weniger. Nur dank der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der niedrigen Zinsen schaffte es die Republik Österreich im vergangenen Jahr, keine neuen Schulden aufzunehmen. Ambitioniert sieht anders aus.
Während sich die industrialisierte Welt mit Volldampf dem digitalen Umbruch widmet, wird hierzulande noch an einer analogen Zukunft geschraubt. Regulierungen, Bürokratie und Intransparenz verhindern Wettbewerb und Erneuerung sowie Klarheit darüber, was hinter den Kulissen tatsächlich passiert. Das muss sich ändern, will Österreich seinen hohen Wohlstand erhalten und weiter ausbauen.
Handlungsempfehlungen
Den Faktor Arbeit deutlich und dauerhaft entlasten: Die wichtigste Maßnahme bleibt, die Steuer- und Abgabenlast merklich zu senken. Und das nicht nur gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Vielmehr sollten Arbeitnehmer weniger Geld vom erwirtschafteten Einkommen an den Staat abführen müssen. Eine Steuerentlastung müsste daher mehr als nur die Rückgabe der automatischen Steuererhöhungen durch die kalte Progression enthalten. Insgesamt sollten die Steuern auf Arbeit im Ausmaß von acht bis neun Milliarden Euro gesenkt werden, um die Belastung auf das Niveau der Eurozone zu senken. Einem Durchschnittsverdiener würden so rund 3.100 Euro mehr im Jahr übrig bleiben. Damit die Entlastung nicht gleich wieder verpufft, muss die Steuersenkung mit der Abschaffung der kalten Progression einhergehen. So wäre eine zukünftige Steuersenkung dann auch eine wirkliche Entlastung.
Länger leben, länger arbeiten: Der größte Ausgabeposten im Budget ist das öffentliche Pensionssystem. Soll die Abgabenlast dauerhaft gesenkt werden, geht das nicht, ohne ausgabenseitig einzusparen. Damit diese Einsparungen nicht in einer niedrigeren Pension enden, muss die steigende Lebenserwartung beim gesetzlichen Pensionsantrittsalter berücksichtigt werden. Konkret: Das gesetzliche Pensionsantrittsalter muss ab sofort jedes Jahr um zwei Monate angehoben werden, bis 67 Jahre erreicht sind. Anschließend wäre das gesetzliche Pensionsantrittsalter automatisch an die zunehmende Lebenserwartung anzupassen. Das System wäre so zu gestalten, dass die in der Pension verbrachte Zeit zwar weiter steigt, aber das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Pension gleichbleibt.
Das Ausgabenproblem lösen: Österreich hat ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem, wie die Agenda Austria seit ihrer Gründung betont. Damit künftig in guten Jahren regelmäßig Überschüsse anfallen, braucht es eine funktionstüchtige Ausgabenbremse. Vorbild könnte hier Schweden sein: Dort gibt es seit 2010 für den Bund ein Überschussziel von einem Prozent des BIP. Weil diese Vorgabe für den Zeitraum eines ganzen Konjunkturzyklus gilt, ist das Land in Krisenzeiten dennoch handlungsfähig. Begleitet wird die Regel von einer Ausgabenbeschränkung. Hierbei wird im Parlament das Budget für mindestens drei Jahre unter Einhaltung des Überschussziels beschlossen.
Der Staat im 21. Jahrhundert: Die Verwaltung muss transparenter und digitaler werden. Erste Schritte wurden bereits von Vorgängerregierungen unternommen, es fehlt aber ein Gesamtkonzept, das den Bürger in den Mittelpunkt rückt und klärt, wie die Daten auch innerhalb der Behörden zu nutzen sind. Es gibt Vorbilder wie Estland, wo inzwischen fast jeder Verwaltungsakt mobil erledigt wird. Auch hierzulande sollten alle Behördengänge in Zukunft über ein zentrales Portal möglich sein. Die dortige Verarbeitung der Daten muss transparent nachverfolgbar sein, um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen und Missbrauch zu verhindern.
Kapital aktivieren: Damit mehr Geld in junge Unternehmen investiert wird, braucht es Anreize für die Geldgeber. Daher wäre es wichtig, Verluste aus Beteiligungen nicht nur im Jahr des Verlusteintrittes absetzen zu können, sondern auf mehrere Jahre verteilt. Im Bereich der Risikokapitalfinanzierung sollte daher eine mehrjährige Durchrechnungsperiode geschaffen werden, in der die Verluste aus Investitionen mit den Gewinnen steuerlich gegengerechnet werden können. Im Gegenzug könnte die öffentliche Hand als Investor in den Hintergrund treten. Gegenwärtig erschweren es die öffentlichen Gelder privaten Investoren gerade in frühen Phasen, in vielversprechende Start-ups zu investieren, da sie mit den Konditionen öffentlicher Anbieter oft nicht konkurrieren können.
Mehr Ressourcen bei höherem Bedarf: Österreich steckt viel Geld in das Bildungssystem. Allein die Resultate aus den internationalen Vergleichstests weisen darauf hin, dass davon zu wenig bei den Schülern ankommt. Der Staat muss also nicht mehr, sondern besser in die Bildung investieren. Für das Budget von Schulen sollte daher ein Sozialindex (Alltagssprache, Bildungshintergrund der Eltern etc.) berücksichtigt werden. Schulen mit einem hohen Anteil an Kindern aus bildungsfernen Schichten sollten zusätzliche Mittel erhalten. Direktoren haben gleichzeitig mehr Personalverantwortung und können sich die Lehrer aussuchen – jene, die für den Beruf weniger geeignet sind, also auch kündigen. Allerdings sind Schulen rechenschaftspflichtig und müssen auch nachweisen können, dass die Schüler durch die zusätzlichen Mittel auch deutlich vorangekommen sind.
Verpflichtend transparent: In Österreich ist es der unangemessene Normalfall, dass Behörden ihr Tun gerne in den Mantel des Schweigens hüllen. Ein umfassendes Recht auf Information und Einsicht in die Akten der Verwaltung sollte Usus sein. Überall dort, wo das Geld des Bürgers verwendet wird, muss maximale Transparenz herrschen. Verträge der Regierung sollten ebenso einsehbar sein wie die Mittelverwendung unserer Zwangsvertretungen.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





