Die Herrschaft der Bürokratie

- 17.09.2019
- Lesezeit ca. 2 min
LEISTUNG. AUFSTIEG. SICHERHEIT.
Deregulierung, Bürokratieabbau und mehr Tempo: All das nahm sich die alte Bundesregierung in puncto Verwaltung vor. Geworden ist daraus wenig. Die zukünftige Bundesregierung sollte das Vorhaben mit Nachdruck angehen.
Zwar hat die Vorgängerregierung eine sogenannte „Bürokratiebremse“ versprochen, zu ihrer Umsetzung kam es allerdings nicht. Auch jetzt im Vorwahlkampf fordert die ÖVP erneut eine verpflichtende Verwaltungsbremse. Ziel sei es, die Kosten der Bürokratie jedes Jahr um zehn Prozent zu reduzieren. Damit wolle man mehr Freiheit für Bürger und Unternehmen schaffen. An Gelegenheiten dafür herrscht in Österreich jedenfalls kein Mangel.
Österreich, ein Bürokratiemonster
 Denn ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie fest die Bürokratie Österreich im Griff hat. Das World Economic Forum publiziert jedes Jahr in seinem Competitiveness Report eine Rangliste, die abbildet, inwieweit die Bürokratie die Tätigkeit von Unternehmen im Land erschwert.[1]Österreich schaffte es 2018 mit Platz 63 zwar ins Mittelfeld der 140 untersuchten Staaten, europäische Vergleichsländer wie die Schweiz (8), Deutschland (7) oder Schweden (23) schnitten aber deutlich besser ab.[2]
Denn ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie fest die Bürokratie Österreich im Griff hat. Das World Economic Forum publiziert jedes Jahr in seinem Competitiveness Report eine Rangliste, die abbildet, inwieweit die Bürokratie die Tätigkeit von Unternehmen im Land erschwert.[1]Österreich schaffte es 2018 mit Platz 63 zwar ins Mittelfeld der 140 untersuchten Staaten, europäische Vergleichsländer wie die Schweiz (8), Deutschland (7) oder Schweden (23) schnitten aber deutlich besser ab.[2]
Auch die Weltbank bestätigt diesen Befund. Der von ihr erstellte „Ease of Doing Business“-Indikator misst, wie einfach (oder schwer) es ist, unternehmerisch tätig zu werden. Hier rangiert Österreich im Jahr 2018 auf Platz 26 von 190 Vergleichsländern.[3]Schweden (12) und Deutschland (24) liegen in diesem Ranking erneut vor Österreich (die Schweiz folgt auf Rang 38).
Bürokratie bremsen, Wachstum fördern
Laut OECD könnten wettbewerbsfördernde Maßnahmen in Österreich das Wachstum von Produktivität und Beschäftigung deutlich steigern. Allerdings beeinträchtigen die gesetzlichen Beschränkungen den Wettbewerb.[4]Insbesondere der Dienstleistungssektor ist von übermäßig strengen Regulierungen betroffen. Die Europäische Kommission fordert Österreich immer wieder dazu auf, mehr Konkurrenz zu ermöglichen.[5]Auch Vorschriften wie Gebietsschutz und Öffnungszeiten schränken den Markteintritt unnötig ein und führen zu höheren Preisen für Verbraucher. Dadurch wird das Wachstum geschwächt, weil weniger gekauft und damit auch weniger produziert wird, als dies bei niedrigeren Preisen möglich wäre.
Ein Relikt aus der Zeit Kaiser Franz Joseph I., über das sich die eingesessenen Betriebe noch heute freuen dürfen, ist die Gewerbeordnung. Eingeführt wurde sie im Jahr 1859 mit dem Ziel, „die gewerbliche Betriebsamkeit in unserem Reiche gleichmäßig zu regeln und möglichst zu erleichtern …“ (Kundmachungspatent).
Nun hat sich das mit dem „Reiche“ mittlerweile erledigt – das mit der Erleichterung ebenso. Durch die enorme Überfrachtung im Laufe der Jahrzehnte wurde das ursprüngliche Ziel aus den Augen verloren. Wer Unternehmer sein darf und wer nicht, bestimmt in Österreich letzten Endes die Wirtschaftskammer – also die eigene Standesvertretung und damit die angestammten Betriebe. Hier gilt es abzuwägen: Jedes neue Mitglied erhöht die Einnahmen der Kammern, stellt aber auch eine Bedrohung für die Existenz bereits etablierter Unternehmen dar. Begründet wird die Notwendigkeit einer strengen Regulierung vor allem mit dem Schutz der Konsumenten. Nur wer eine Meisterprüfung abgelegt hat, sei auch imstande, den Verbrauchern in sensiblen Geschäftsbereichen die nötige Qualität zu bieten.
Das Argument hat etwas für sich – ignoriert aber einen wichtigen Umstand: Der Gewerbeinhaber muss den Nachweis erbringen, aber nicht seine Mitarbeiter, die den Kunden versorgen. Nehmen wir nur das Beispiel eines Optikers: Niemand wird bestreiten wollen, dass die Tätigkeit im Interesse der Kunden jede Menge Fachwissen verlangt und zweifellos zu jenen Gewerben zählt, deren Ausübung strengen Regulierungen zu unterliegen hat. Um das Optiker-Gewerbe auszuüben, braucht es deshalb auch eine Meisterprüfung – aber keine Anwesenheitspflicht des Meisters. Nur so konnten sich große Optiker-Ketten in Österreich etablieren, unzählige Standorte teilen sich einen Meister. In welcher Filiale dieser gerade anwesend ist, weiß niemand. Es fragt auch beim Betreten einer Filiale niemand, ob der Meister gerade da ist, weil davon auszugehen ist, dass dies der Fall ist. Wie es aussieht, dürfte das in der Praxis auch ganz gut funktionieren.
Es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, dass die strenge Regulierung nicht so sehr die Verbraucherim Auge hat, sondern vielmehr die eingesessenen Unternehmen, denen neue Konkurrenz vom Leibe gehalten werden soll. Streng reglementiert werden sollten in Zukunft nur noch jene Gewerbe, deren Ausübung Mensch, Tier oder Umwelt gefährdet (siehe Handlungsempfehlung).
Staat kommt auch mit hohen Einnahmen nicht aus
 Die Bürokratie hemmt nicht nur Unternehmen und Bürger, sondern auch den Staatsapparat selbst. Seine Dienstleistungen für den Bürger werden dadurch ebenfalls teurer. So kommt es, dass der Staat trotz immer weiter steigender Einnahmen nur äußerst selten das Auslangen findet.
Die Bürokratie hemmt nicht nur Unternehmen und Bürger, sondern auch den Staatsapparat selbst. Seine Dienstleistungen für den Bürger werden dadurch ebenfalls teurer. So kommt es, dass der Staat trotz immer weiter steigender Einnahmen nur äußerst selten das Auslangen findet.
Eine der Ursachen dafür ist, dass die Löhne im öffentlichen Sektor deutlich schneller wachsen als in der freien Wirtschaft – ohne dass der Staat mit einer besonders hohen Produktivitätssteigerung auffallen würde. Ein echtes Sparen im System wäre also durchaus im Rahmen des Möglichen. Hätten sich Löhne und Produktivität in den öffentlichen Institutionen genauso entwickelt wie in der Privatwirtschaft, wären den Steuerzahlern allein im Jahr 2016 Ausgaben um knapp 15 Milliarden erspart geblieben.[6]
Die Länder in die Verantwortung nehmen
Auch die Art und Weise, wie die Republik den Föderalismus lebt, ist einer der Gründe für übermäßig stark steigende öffentliche Ausgaben. Macht und Verantwortung unterliegen entweder zentraler Entscheidungsbefugnis oder sie lassen sich autonom auf die föderalen Einheiten verteilen. Während in Dänemark vieles zentral beschlossen wird, werden in der Schweiz zahlreiche wichtige Entscheidungen auf Ebene der Kantone und Gemeinden getroffen. In beiden Fällen gilt: Dort, wo die Entscheidung zu den Ausgaben fällt, da muss auch das Geld eingehoben werden. Österreich hingegen lebt die teuerste Form des Föderalismus: einen Einnahmenzentralismus kombiniert mit einem Ausgabenföderalismus. Wer die Steuern einnimmt, hat wenig bis nichts zu melden. Wer das eingenommene Geld ausgibt, schafft an.
Was bedeutet das nun im Detail? In Österreich können Länder und Gemeinden derzeit kaum Steuern selbst festlegen – so gut wie alle Steuereinnahmen werden vom Bund abgeschöpft und für die Erledigung regionaler Aufgaben mit einem fixen Verteilschlüssel wieder an die Länder und Gemeinden zurücküberwiesen. Das alles passiert im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Bürger zahlen für die Leistungen zu viel, weil die Einnahmen- und die Ausgabenverantwortung zu weit auseinanderliegen. Bisher haben die Länder keinen Anreiz zu sparen – eine Steuerautonomie hätte zur Folge, dass Regionalpolitiker für höhere Ausgaben auch höhere Steuern vor Ort einheben müssten, was wiederum einen sorgsameren Umgang mit dem Geld der Steuerzahler bewirken würde. Während die Bundesländer ihre Ausgaben mit nicht einmal drei Prozent über eigene Steuern finanzieren, gehen fast 17 Prozent der Staatsausgaben auf ihr Konto.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen 'Abb. 22: Macht braucht Verantwortung. In Österreich heben die Länder und Gemeinden nur sehr wenig Geld selbst ein.
Noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen in dieser Debatte die österreichischen Gemeinden. Sie sind, auch im Vergleich mit Kommunen in anderen Industrieländern, finanziell kaum eigenständig – und hier gilt es anzusetzen: Die Gemeinden wissen am besten, was ihre Bevölkerung braucht und was ihre steuerlichen Spielräume sind, weil sie eine besondere Nähe zu ihren Bewohnern haben. Sie können außerdem schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren. Wenn der Föderalismus in Österreich reformiert werden soll, sollte daher unbedingt auch auf eine höhere finanzielle Autonomie der Gemeinden geachtet werden. Samt der Verpflichtung, einen höheren Anteil ihrer Ausgaben selbst einzuheben.
Handlungsempfehlungen
Wettbewerb forcieren: In Österreich wird Wettbewerb gerne vermieden. Unsere Bauern sollen nicht mit Argentinien konkurrieren müssen und unsere Handwerker nicht mit jenen aus Polen. Deswegen gilt in Österreich auch noch vieles als streng reguliert. Wer günstigere Preise und höheren Wohlstand für das Land will, der findet im Wettbewerb aber einen treuen Freund. Österreich sollte die Öffnungszeiten freigeben und den Gebietsschutz für die freien Berufe aufheben. Zudem gehört die Gewerbeordnung gründlich entrümpelt. So gab es zwar kürzlich eine sanfte Liberalisierung, in der die Anzahl der streng regulierten Gewerbe von 80 auf 75 reduziert wurde.[7]Wirklich frei ist die Wirtschaft deswegen aber nicht. Immerhin trifft der von der Verfassung gerechtfertigte Schutz vor Gefahren für Menschen, Tiere und Umwelt nicht auf alle Gewerbe zu. Denn Buchbinder, Friseure und Floristen stellen keine Gefahrenquelle dar – und werden dennoch streng mit einem Zwang zum Befähigungsnachweis reguliert. Die Konsequenzen sind ein erhöhter bürokratischer Aufwand und ein eingeschränkter Wettbewerb. Daher sollte die Gewerbeordnung nur jene Berufe regulieren, von deren Ausübung Gefahr für Menschen, Tiere und Umwelt ausgehen kann.
Folgende Berufe würden etwa darunterfallen:[8]
1. Baumeister
2. Chemische Laboratorien, Herstellung von
Arzneimitteln und Giften
3. Elektrotechniker
4. Gas- und Sanitärtechniker
5. Zimmermeister
6. Technische Büros
7. Sprengungsunternehmer
8. Herstellung von Medizinprodukten
9. Augenoptiker und Kontaktlinsenoptiker
10. Waffengewerbe (Büchsenmacher)
11. Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln und Zündmitteln
12. Zahntechniker
13. Orthopädietechniker
14. Hörgeräteakustiker
15. Rauchfangkehrer
In Deutschland wurden bereits 2004 unter der Regierung von SPD und Grünen 53 von ehemals 94 Handwerken liberalisiert, deren Ausübung bis dahin eine Meisterprüfung erforderte. 41 Tätigkeiten blieben reguliert, aber nur noch für sechs von ihnen wird auch heute noch eine Meisterprüfung verlangt. Infolge der Liberalisierung machten sich viele Angestellte selbständig. Besonders stark gestiegen ist die Gründungsneigung naturgemäß bei weniger qualifizierten Handwerkern innerhalb der freigegebenen Gewerbe. Die Anzahl der deregulierten Betriebe ist im Handwerk von 74.940 auf 235.818 (2003 bis 2015) angewachsen, hat sich also mehr als verdreifacht.[9]Mit anderen Worten: Der Konkurrenzdruck stieg, aber in Summe gibt es heute in Deutschland deutlich mehr Unternehmen als vor der Liberalisierung. Die Anzahl der Beschäftigten im Handwerk hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Zurückgegangen ist hingegen die Zahl der Lehrlinge – allerdings nicht nur in den liberalisierten, sondern auch in den weiterhin regulierten Berufen. Dasselbe trifft auch auf das streng regulierte Österreich zu. Hauptgrund dafür ist der demografische Wandel: Es gibt heute deutlich weniger 15-Jährige als noch vor 20 oder 30 Jahren. Und dementsprechend weniger Lehrlinge.
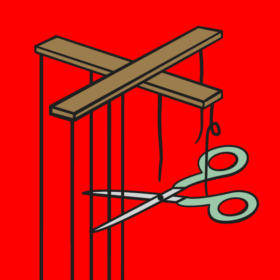 Regulierung herunterfahren: Regulierungen wachsen hierzulande so sicher wie die Einnahmen des Finanzministers. Daher hat die türkis-blaue Regierung 2017 ein sogenanntes „Deregulierungsgrundsätzegesetz“ beschlossen. Es soll sicherstellen, dass neue Bundesgesetze notwendig, zeitgemäß und die beste Form der Zielerreichung sind. Das Gesetz sieht vor, dass EU-Richtlinien nicht mehr übererfüllt werden sollen (in der Fachsprache „Gold Plating“ genannt). Bei neuen Regulierungen auf Bundesebene sollen nach Möglichkeit ältere Regulierungen im gleichen Verwaltungs- und Kostenausmaß entfallen („One in, one out“-Regel), sodass die Belastung nicht weiter steigt. Zudem sollen Rechtsbestimmungen des Bundes in regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Wirkungsweise evaluiert werden und auch ein vordefiniertes Ablaufdatum erhalten (Review- und Sunset- Klausel). Dieses kann aber durch die Politik immer wieder aufs Neue verlängert werden.[10]Die im Gesetz festgehaltenen Bemühungen müssen zusätzlich durch eine unabhängige Instanz überprüft werden, damit das Gesetz auch seine Wirkung entfalten kann. Der Rechnungshof sollte daher in Zukunft Regulierungen auf ihre Kosteneffizienz und Wirksamkeit überprüfen. Dieser Vorgang wird bereits im Vereinigten Königreich erfolgreich praktiziert.
Regulierung herunterfahren: Regulierungen wachsen hierzulande so sicher wie die Einnahmen des Finanzministers. Daher hat die türkis-blaue Regierung 2017 ein sogenanntes „Deregulierungsgrundsätzegesetz“ beschlossen. Es soll sicherstellen, dass neue Bundesgesetze notwendig, zeitgemäß und die beste Form der Zielerreichung sind. Das Gesetz sieht vor, dass EU-Richtlinien nicht mehr übererfüllt werden sollen (in der Fachsprache „Gold Plating“ genannt). Bei neuen Regulierungen auf Bundesebene sollen nach Möglichkeit ältere Regulierungen im gleichen Verwaltungs- und Kostenausmaß entfallen („One in, one out“-Regel), sodass die Belastung nicht weiter steigt. Zudem sollen Rechtsbestimmungen des Bundes in regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Wirkungsweise evaluiert werden und auch ein vordefiniertes Ablaufdatum erhalten (Review- und Sunset- Klausel). Dieses kann aber durch die Politik immer wieder aufs Neue verlängert werden.[10]Die im Gesetz festgehaltenen Bemühungen müssen zusätzlich durch eine unabhängige Instanz überprüft werden, damit das Gesetz auch seine Wirkung entfalten kann. Der Rechnungshof sollte daher in Zukunft Regulierungen auf ihre Kosteneffizienz und Wirksamkeit überprüfen. Dieser Vorgang wird bereits im Vereinigten Königreich erfolgreich praktiziert.
Um den bestehenden Regulierungsberg abzutragen, aber dennoch handlungsfähig zu bleiben, sollte eine sogenannte „One in, one out“-Regelung nach britischem Vorbild eingeführt werden. Diese gibt vor, dass neue Regulierungen nur dann erlassen werden, wenn dafür andere, bereits bestehende Regulierungen im doppelten Kostenumfang entfallen.
Die Bundesländer in die Pflicht nehmen: Der österreichische Föderalismus existiert hauptsächlich auf der Ausgabenseite. In kaum einem anderen OECD-Land finanzieren Bundesländer ihre Ausgaben zu einem so niedrigen Anteil über eigene Steuern wie in Österreich. Wäre es Österreichs Bundesländern möglich, unterschiedliche Steuern einzuheben, könnten diese besser auf örtliche Gegebenheiten eingehen. Ein positives Beispiel dafür ist die Schweiz: In einem Ballungsraum wie Zürich hat die öffentliche Hand andere Aufgaben zu erledigen als in einem Bergkanton und hebt daher aus guten Gründen höhere Steuern ein.
Zudem würde es zu einem Wettbewerb und damit sorgsameren Umgang mit Steuergeld führen. In einem ersten Schritt sollte der Bund die Steuertarife für die Lohn- und Einkommensteuer um rund sieben Prozentpunkte senken und im Gegenzug sollten die Bundesländer einen Zuschlag im gleichen Ausmaß einheben. Damit würden die gesamten Steuereinnahmen erst einmal gleichbleiben. Profitieren würden davon Wien und Niederösterreich. Weniger Einnahmen würden das Burgenland, Kärnten und Tirol erzielen. Die Einnahmen in Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg würden sich nur geringfügig verändern. Zur Wahrung des Status quo würde der Finanzausgleich diese Unterschiede aufheben. Gleichzeitig sollte die versteckte Umverteilung des Bundesfinanzausgleichs auf einen transparenten Finanzausgleich zwischen den Bundesländern umgestellt werden und damit eine Nivellierung von den reichen hin zu den ärmeren Bundesländern erfolgen. In einem nächsten Schritt könnten dann die Bundesländer autonom ihre Zuschläge gestalten. Sollen Arbeitnehmer angelockt werden, könnten die Zuschläge gesenkt werden. Zur Finanzierung von Standortprojekten könnten sie aber auch erhöht werden. Auch die Körperschaftsteuer sollte in einem zweiten Schritt in einer Kombination aus Bundessteuer und föderalen Zuschlägen eingehoben werden.
Fußnoten
- Teilindex: Burden of government regulation. ↩
- Vgl. World Economic Forum (2018). ↩
- Vgl. Weltbank (2019). ↩
- Vgl. OECD (2015). ↩
- Vgl. EU-Kommission (2019f). ↩
- Vgl. Köppl-Turyna et al. (2017). ↩
- Freigegeben wurden allerdings nur zwei Bereiche (Arbeitsvermittlung und Erzeugung von kosmetischen Artikeln). Die restliche Reduktion erfolgte aufgrund einer Zusammenlegung von Gewerben im Textilbereich ↩
- Zahlreiche andere Gewerbe, deren Ausübung Leib und Leben gefährden, sind hier nicht ausdrücklich erwähnt, weil sie bereits außerhalb der Gewerbeordnung reguliert sind – wie etwa medizinische Laboratorien oder Apotheken. Diese Gewerbe sollen nicht dereguliert werden und sie sind nicht Thema der Gewerbeordnung. Chemische Laboratorien sollten entweder über das Gesetz oder in der Gewerbeordnung geregelt werden. Wir haben uns für die Gewerbeordnung entschieden. ↩
- Vgl. Rostam-Afschar (2014). ↩
- Siehe Deregulierungsgrundsätzegesetz ¨1: (Abs 4) „Bei der Vorbereitung der Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Union ist darauf zu achten, dass die vorgegebenen Standards nicht ohne Grund übererfüllt werden. (Abs 2) Zur Vermeidung weiterer Belastungen wird jede Neuregelung, aus der zusätzlicher bürokratischer Aufwand oder zusätzliche finanzielle Auswirkungen erwachsen, nach Tunlichkeit durch Außerkraftsetzung einer vergleichbar intensiven Regulierung kompensiert. (Abs 5) Rechtsvorschriften des Bundes sind in angemessenen Zeitabständen zu evaluieren; sie sollen nach Möglichkeit nur für einen bestimmten, von vornherein festgelegten Zeitraum in Geltung treten. Befristet erlassene Rechtsvorschriften sind vor Ablauf des festgesetzten Anwendungszeitraums im Hinblick auf weitere Notwendigkeit zu evaluieren.“ ↩
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





