“Frihet”
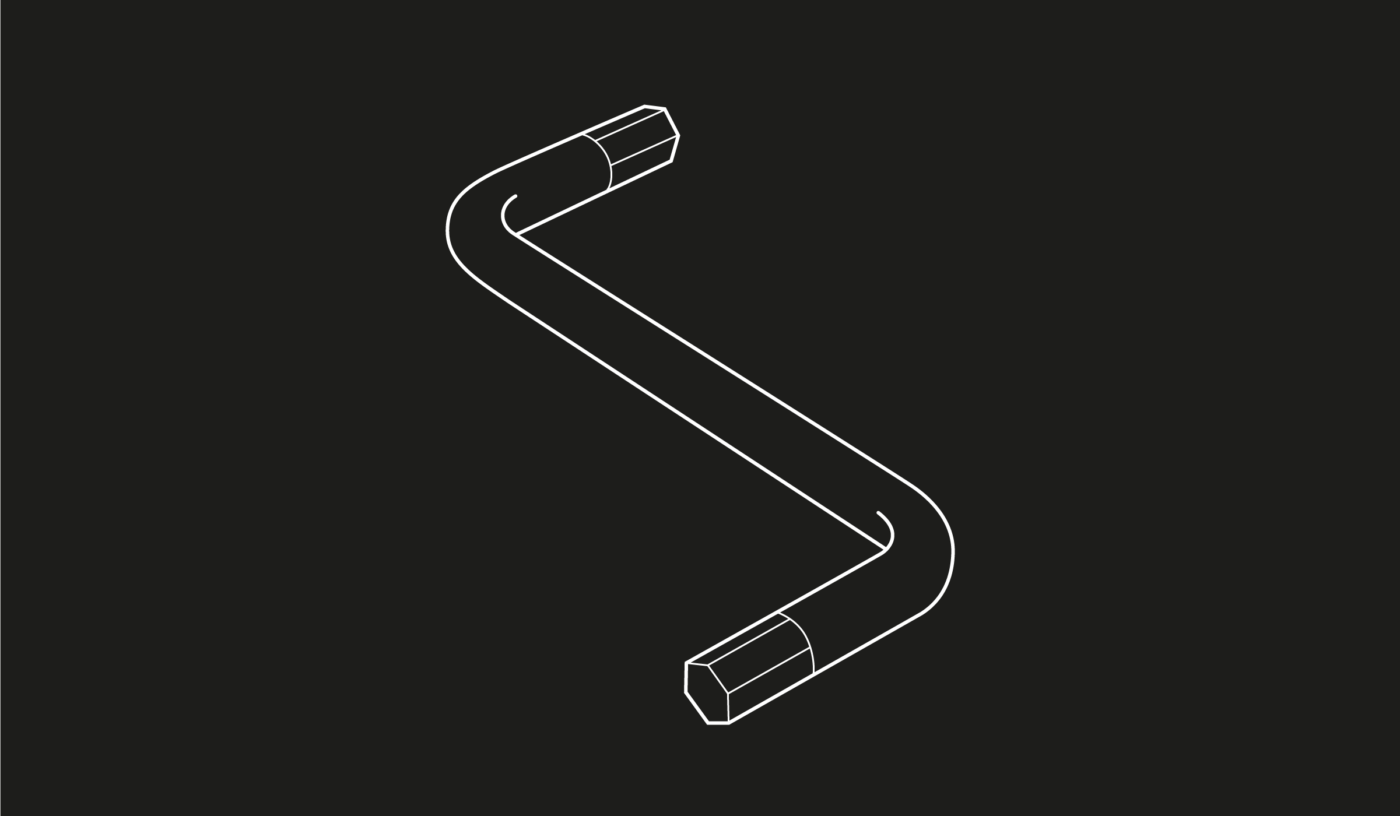
- 19.12.2021
- Lesezeit ca. 4 min
Der Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit
Warum ökonomische Freiheit wichtig ist
Bereits Adam Smith hat als Erster wissenschaftlich nachgewiesen, dass ökonomische Freiheit den Wohlstand mehrt. Das funktioniert primär über Arbeitsteilung, d. h., jeder tut, was er am besten kann. Somit wird insgesamt mehr produziert und es gibt in weiterer Folge mehr Güter und Dienstleistungen für alle – zu günstigeren Preisen. Aber wie finden wir überhaupt heraus, wo unsere Talente liegen, für welche Arbeit wir am besten geeignet sind? Wir müssen uns versuchen. Es muss uns auch möglich sein, zu scheitern und umzusatteln. Kurz: Die Trial-and-Error-Methode sorgt für den optimalen Einsatz unserer Talente in einer arbeitsteiligen Wirtschaft. Wenn der Staat den Einsatz von Ressourcen vorgeben möchte, wird dieser Trial-and-Error-Prozess ausgehebelt.
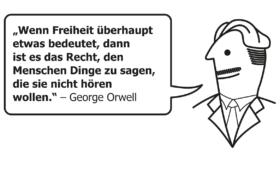 Das Recht auf Privateigentum sticht heraus, wenn man Wachstum und Wohlstand geschichtlich betrachtet. Es ist eine zentrale wirtschaftliche Freiheit, die Grundlage der modernen Zivilisation. Im Mittelalter gab es kaum Wachstum, 0,1 Prozent im Jahr vielleicht. Wer arm geboren wurde, ist arm gestorben. Diese Stagnation war vor allem darauf zurückzuführen, dass es so gut wie keine Eigentumsrechte für Kaufleute und Händler gab. Und wenn doch, waren permanent Enteignungen durch Monarchen zu befürchten. Aus diesem Grund gab es für Kaufleute auch keinerlei Anreiz, in Land, physisches Kapital oder Humankapital zu investieren.
Das Recht auf Privateigentum sticht heraus, wenn man Wachstum und Wohlstand geschichtlich betrachtet. Es ist eine zentrale wirtschaftliche Freiheit, die Grundlage der modernen Zivilisation. Im Mittelalter gab es kaum Wachstum, 0,1 Prozent im Jahr vielleicht. Wer arm geboren wurde, ist arm gestorben. Diese Stagnation war vor allem darauf zurückzuführen, dass es so gut wie keine Eigentumsrechte für Kaufleute und Händler gab. Und wenn doch, waren permanent Enteignungen durch Monarchen zu befürchten. Aus diesem Grund gab es für Kaufleute auch keinerlei Anreiz, in Land, physisches Kapital oder Humankapital zu investieren.
Die Geschichte des Privateigentums
Erst im 17. Jahrhundert, als der Wohlstand von Kaufleuten aufgrund des wachsenden Handels zunahm, konnten sich diese auch Söldnerheere zum eigenen Schutz leisten. Längerfristige Planung wurde möglich. Auch der Widerstand gegen die Willkür von Monarchen wuchs zunehmend – und löste zum Teil auch Revolutionen aus. Diese Entwicklungen führten insgesamt zu einer radikalen Veränderung politischer Institutionen. Die Monarchen verloren an Macht. Eigentumsrechte wurden sukzessive gestärkt. Die Konsequenz: In vielen Ländern kam es erstmals zu starkem Wirtschaftswachstum. Die industrielle Revolution wurde angestoßen – mit den bekannten, positiven Folgen für Wohlstand und technologischen Fortschritt.
Auch empirisch wurde der Einfluss unterschiedlicher Faktoren ökonomischer Freiheit im Hinblick auf Wachstum klar nachgewiesen. Hier nur einige der Zusammenhänge: Je höher die Staatsausgaben pro Kopf, desto niedriger das Wachstum. Je besser das Rechtssystem und die Ausprägung von Eigentumsrechten, desto höher das Wachstum.[1] Der Zusammenhang zwischen Wachstum und Demokratie ist komplexer. Ausgehend von einem totalitären System erhöht die Demokratisierung Wachstum. Aber: Bei einem hohen Demokratiegrad ist eine weitere Demokratisierung tatsächlich schädlich. Grund ist der Einfluss von Interessengruppen sowie die Umverteilung durch hohe Steuern, die Investitionen behindern.
Was aber, wenn Staat und Regierung bürokratische Hürden aufbauen, die es erschweren oder gar verhindern, dass Individuen neue, profitable Projekte starten? Es geht viel Potenzial der Innovation verloren und Menschen landen massenhaft in Berufen, in denen sie nicht ihren größtmöglichen Teil zum universellen Wohlstand der Gesellschaft beitragen. Je mehr ökonomische Freiheit, desto mehr Innovation und effiziente Arbeitsteilung, desto mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





