“Frihet”
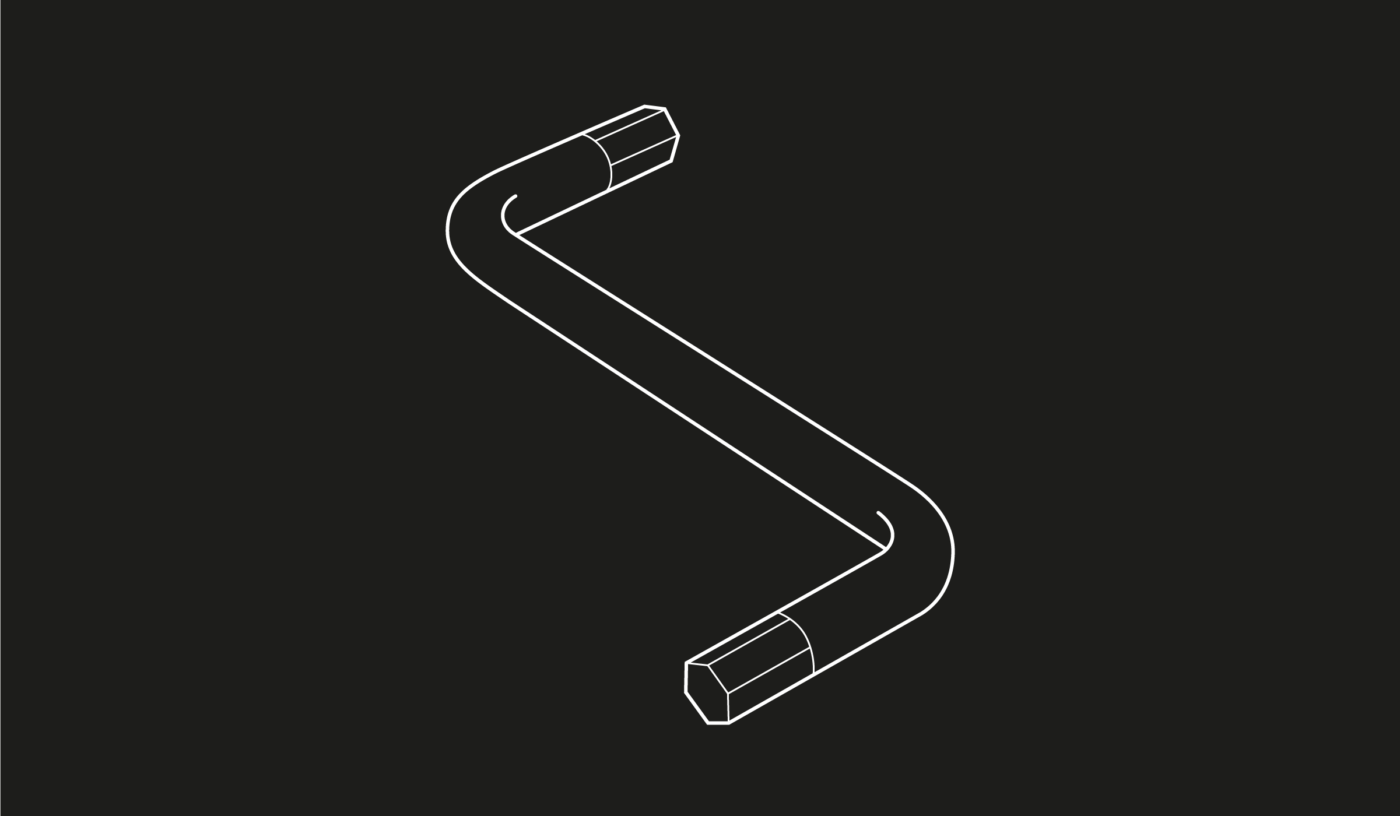
- 19.12.2021
- Lesezeit ca. 4 min
Der Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit
Die Vermessung der ökonomischen Freiheit in Österreich
Ökonomische Freiheit messbar zu machen, ist sehr schwierig. Dass bestimmte Kriterien für eine funktionierende Marktwirtschaft unerlässlich sind, steht außer Frage. Etwa die Wahrung der Eigentumsrechte und ein stabiles Rechtssystem. Außerdem ist die Offenheit einer Volkswirtschaft ein wichtiges Indiz der Freiheit. Frei zu handeln, zu arbeiten und zu investieren ist essenziell für den bestmöglichen Einsatz der Ressourcen. Staatsgrenzen sollten hier keine Rolle spielen.
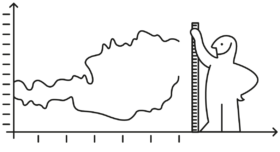 In anderen Belangen ist die ökonomische Freiheit eine Frage von Abwägung und Argumentation. Welche Staatsausgaben sind schädlich, welche sind gut? Welche Steuern sind förderlich, welche hinderlich? Und wie hoch sollen sie sein? Wie viel Regulierung braucht es – und wie groß darf die Bürokratie sein? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, muss man die Qualität der Regeln kennen. Ihre Detailgenauigkeit. Und man muss messen, wie effizient sie umgesetzt werden.
In anderen Belangen ist die ökonomische Freiheit eine Frage von Abwägung und Argumentation. Welche Staatsausgaben sind schädlich, welche sind gut? Welche Steuern sind förderlich, welche hinderlich? Und wie hoch sollen sie sein? Wie viel Regulierung braucht es – und wie groß darf die Bürokratie sein? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, muss man die Qualität der Regeln kennen. Ihre Detailgenauigkeit. Und man muss messen, wie effizient sie umgesetzt werden.
Eine Reihe von Indizes zur ökonomischen Freiheit versucht diese Messung bereits. In ihnen liegt Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Staaten tendenziell im oberen Mittelfeld. Im Ranking der US-amerikanischen Heritage Foundation, dem Index of Economic Freedom, belegte Österreich zuletzt international den 25., regional den 13. Platz.
Österreich als offene Volkswirtschaft
Als EU-Land hat Österreich die Verantwortung in einigen Bereichen abgegeben. Weder das Geldsystem noch die Offenheit der Märkte sind von Wien aus steuerbar. Natürlich profitiert Österreich als kleine, exportorientierte Volkswirtschaft besonders von niedrigen Handelshemmnissen und Freihandelsabkommen – also von mehr ökonomischer Freiheit auf internationaler Ebene. Durch die Globalisierung entstehen in Österreich durchschnittliche Einkommenszuwächse pro Person von rund 1.270 Euro pro Jahr.[1]
Seit der Finanzkrise hat sich die Globalisierung aber verlangsamt – und die Coronakrise hat diesen Trend wohl nicht gestoppt. Daher ist es unerlässlich, dass sich Österreich auch auf EU-Ebene klar gegen protektionistische und Europa-nationalistische Tendenzen ausspricht. Wien muss sich für mehr Freihandelsabkommen und gegen eine Ausweitung z. B. von Zöllen positionieren. Denn schlussendlich profitieren wir alle davon.
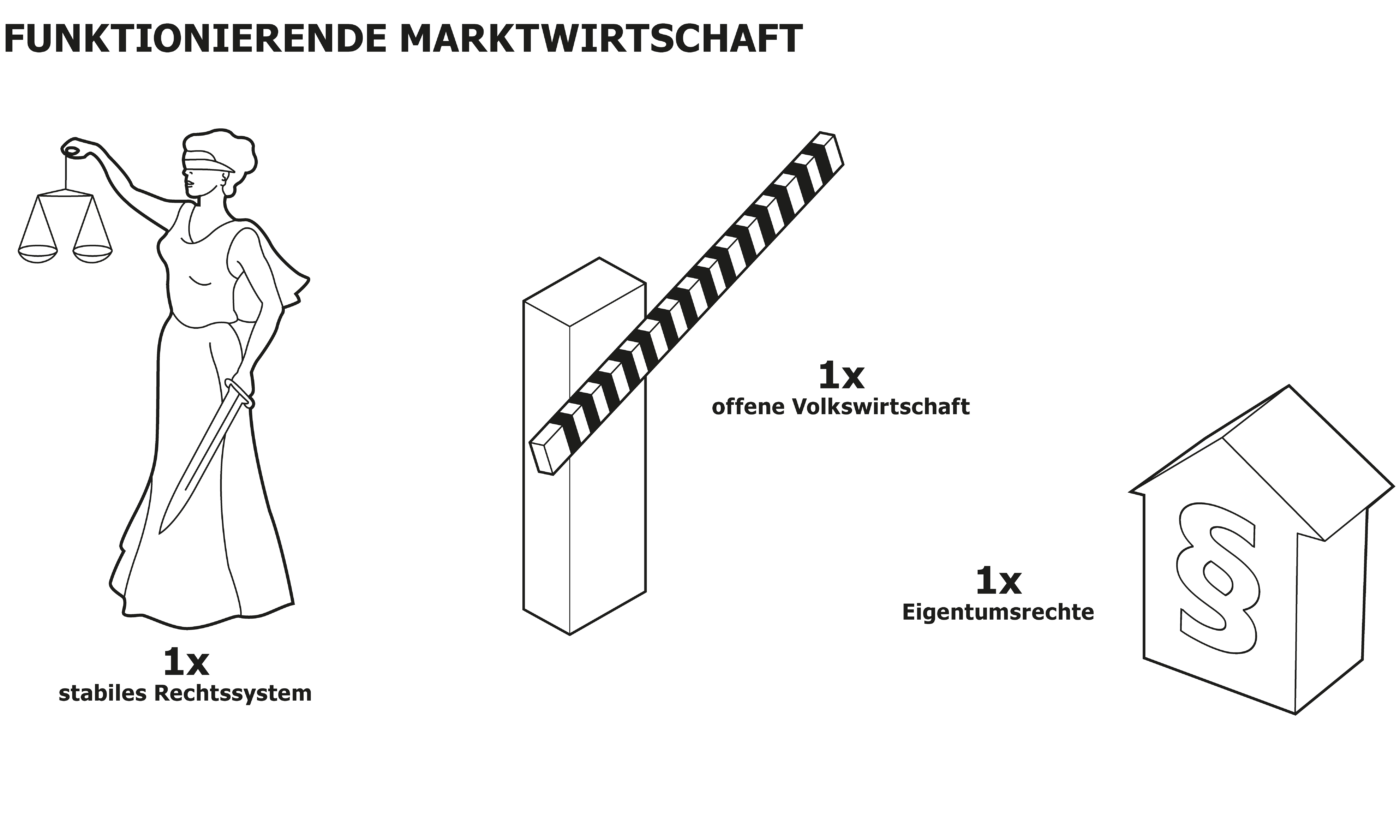
Stabilität des Rechtssystems und Wahrung der Eigentumsrechte
Der World Justice Project Rule of Law Index misst die Stabilität des Rechtssystems anhand unterschiedlicher Indikatoren wie Einschränkungen der staatlichen Gewalt oder der fundamentalen Rechte. Im Vergleich zu anderen Industrieländern im EWR-Raum und den USA liegt Österreich auf Platz neun. Auf den vordersten Plätzen findet man die üblichen Verdächtigen: Skandinavien, Finnland, aber auch Deutschland und die Niederlande. Dass Österreich bei Korruption und Transparenz vergleichsweise schlecht abschneidet, ist leider kaum verwunderlich. Hier ist akut auch keine Besserung in den Rankings zu erwarten – eher das Gegenteil. Dabei sollte insbesondere der Trend zu „Open Government“, also dass der Staat seine Prozesse transparent für jedermann veröffentlicht, in Österreich weiter vorangetrieben werden. Damit die Bevölkerung sieht, wo und wie ihr Geld ausgegeben wird.
Der vermutlich wichtigste Grundpfeiler der ökonomischen Freiheit ist wie erwähnt das Recht auf Eigentum. In Österreich wird dieser Grundsatz aus jetziger Sicht zumindest aus rechtlicher Sicht gut gewahrt. Denn auch manchmal notwendige Enteignungen können nur dann durchgeführt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. Zum Beispiel dann, wenn die eigene Immobilie einer U-Bahn weichen soll. In Österreich muss diese Enteignung dem öffentlichen Interesse dienen und darf nicht unverhältnismäßig sein. Essenziell ist in diesem Fall, dass eine angemessene Entschädigung bezahlt wird. Allerdings könnte diese Betrachtung zu einseitig sein. Auch die hohe Besteuerung von Erwerbseinkommen kann als Hürde auf dem Weg zu Eigentum gesehen werden.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





