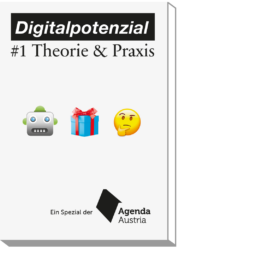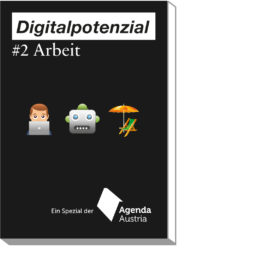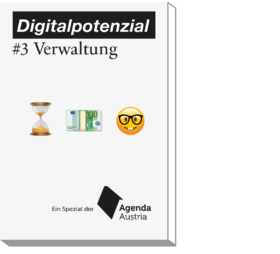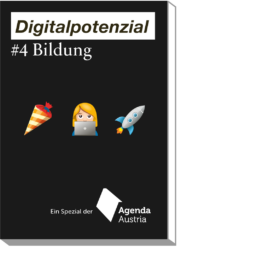Digitalpotenzial #4: Bildung
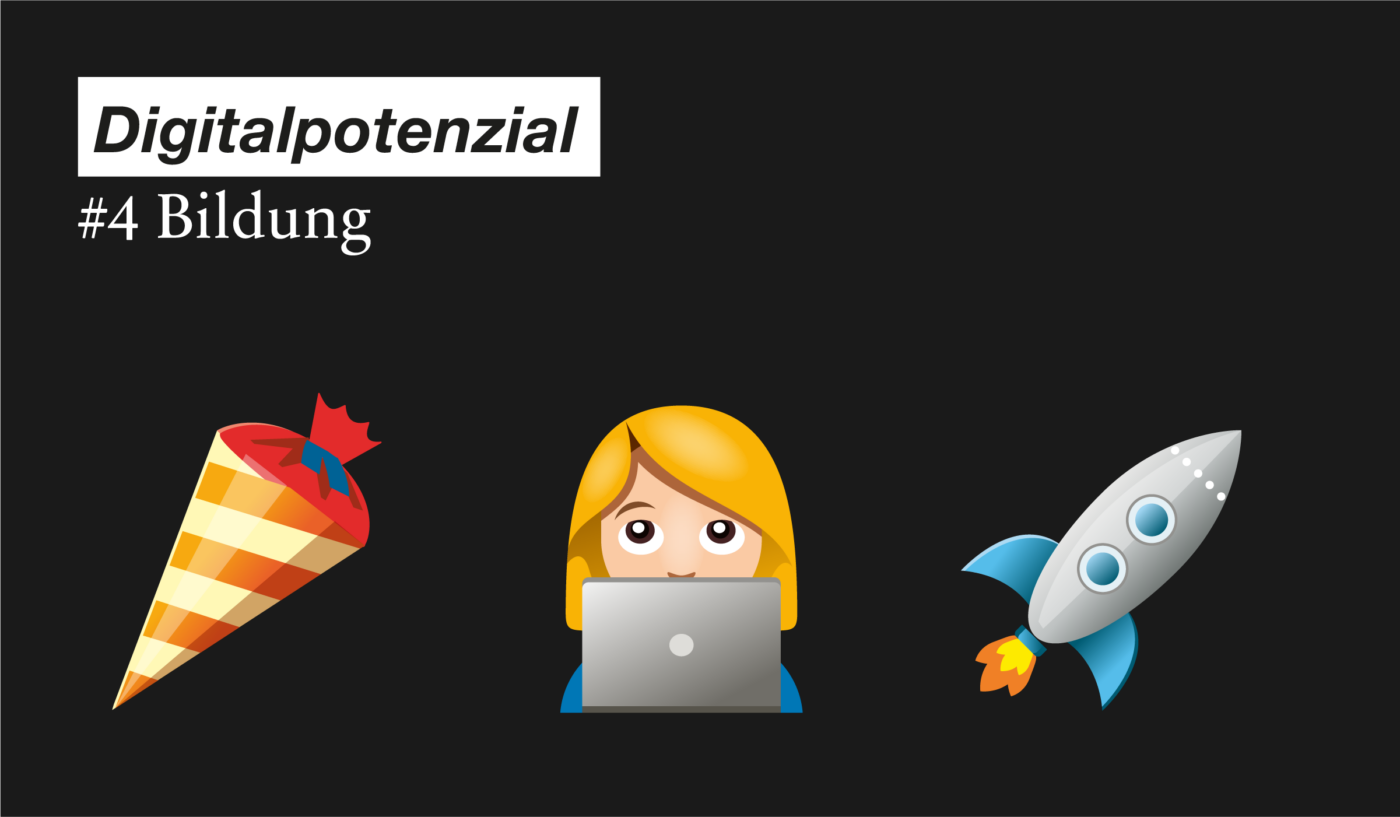
- 04.01.2019
- Lesezeit ca. 2 min
Raus aus der Kreidezeit – neu denken lernen
Wegbegleiter
Wenn sich das österreichische Bildungssystem auf den Weg in Richtung Zukunft machen soll, dann geht das nur mit Veränderungen und neuen Wegbegleitern. Lehrkräfte müssen besser ausgebildet und vorbereitet werden, Schulen müssen in die Lage versetzt werden, mehr Entscheidungen selbstbestimmt und bedarfsorientiert zu treffen.
Qualifikation der Lehrkräfte
Wer besonders gute Bildungschancen für möglichst alle Schüler will, braucht dafür Lehrkräfte, die den damit verbundenen hohen Ansprüchen gerecht werden. Die Fachliteratur weist schon länger auf den Zusammenhang zwischen Lehrerbildung und Erfolg der Schüler hin. [1] Soll die Schule die Kinder und Jugendlichen effektiv auf die digitalen Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, so bedarf es einer entsprechenden Qualifikation der Lehrenden.
In Österreich gibt es für Lehrer zwar eine Pflicht zur Weiterbildung, aber keine inhaltlichen Vorgaben. Der Umfang der Weiterbildung in Österreich ist im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich.[2] In Finnland ist der Auswahlprozess für neue Lehrkräfte sehr streng, dementsprechend genießen Lehrer auch eine hohe gesellschaftliche Anerkennung. In Estland hat man die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung ebenfalls früh erkannt. Alle Lehrer haben dort die erforderlichen Schulungen erhalten, 40 Prozent wurde gar zu IT-Experten weitergebildet.
Mehr Autonomie für Schulen
Neben einer besseren Ausbildung der Lehrkräfte bedarf es auch einer höheren Schulautonomie, um die Leistungsfähigkeit der Schüler zu verbessern. Die Schulautonomie umfasst prinzipiell zwei Bereiche: die Finanz- und Personalautonomie sowie eine Autonomie hinsichtlich der Lehrinhalte. Unter dieFinanz- und Personalautonomie fallen Fragen wie das eigenständige Zusammenstellen des Lehrteams, die Bestimmung der Anfangsgehälter und Gehaltserhöhungen sowie Festsetzung des Schulbudgets und Entscheidung über die Verwendung des Budgets innerhalb der Schulen. Im Bereich der Autonomie der Lehrinhalte geht es vor allem um die Verantwortung für die Lehrplangestaltung und Schülerbeurteilungen innerhalb der Schule, die Wahl der verwendeten Schulbücher sowie eine selbstbestimmte Festlegung des Lehrstoffs, des Kursangebots und der Unterrichtsinhalte. Vorgegeben werden die Ziele, die im Laufe des Schuljahres zu erreichen sind, also welche Inhalte die Kinder beherrschen müssen.
Die Schulausstattung (Infrastruktur, Lehrpersonal etc.) und die damit verbundenen Herausforderungen sind an den Schulen sehr unterschiedlich – deshalb wäre eine individuelle Anpassung durch die jeweilige Schule selbst vernünftig. Lehrer und Schulleiter können am besten einschätzen, mit welchem Lehrplan und welchen Lehrmaterialien der Lernerfolg ihrer Schüler am besten erreicht werden kann – und die Schulleitung kann am ehesten beurteilen, welche Lehrer geeignet sind, um die Schüler bestmöglich zu unterrichten. Sie können erfolgreiche Methoden aus anderen Schulen übernehmen oder selbst Konzepte und Ideen testen und sich dem Wettbewerb stellen.
Studien zeigen, dass eine hohe Schulautonomie in entwickelten Ländern die Bildung verbessern kann. [3] So verweist die OECD[4] auch darauf, dass die Autonomie ein wichtiger Bestandteil eines guten Lernerfolgs der Schüler ist, eine Qualitätssicherung dabei aber unabdingbar ist. Damit einhergehen sollte also eine Rechenschaftspflicht der Schule, beispielsweise durch eine regelmäßige Erhebung der Schüler-Leistungsdaten. Das Ziel sollte landesweit vorgegeben, der Weg dorthin allerdings offen sein.
Auch für die Nutzung digitaler Lehrinhalte ist Autonomie ein wichtiger Bestandteil. Ist es Schulen und Lehrkräften freigestellt, unterschiedliche Hilfsmittel zu verwenden, so können sie sich mit anderen Schulen austauschen, vergleichen und so das Bildungssystem sukzessive verbessern.
Neben der Schulautonomie ist außerdem das Management der Schule mitentscheidend für den Schülererfolg. Klappt die operative Führung der Schule, schneiden auch die Schüler bei Vergleichstests besser ab. [5] Wie in jedem Unternehmen braucht es eine gute Struktur und Führungsstärke, um erfolgreich zu sein.
In Österreich wird die Frage der Schulautonomie bislang eher stiefmütterlich behandelt. Die Zuständigkeiten sind auf vier Ebenen geregelt: Bund, Länder, Gemeinden und Schulen. Trotz gewisser „autonomer“ Handlungsspielräume sind die Schulen als nachgeordnete Dienststellen auf unterster Ebene in eine strikte bürokratische Struktur eingebunden.
Ganz anders in Finnland und Estland: Beide Länder sind im PISA-Ranking sehr stark und verfügen über eine hohe Bildungsautonomie. In Finnland setzt man auf landesweite Rahmenlehrpläne, die aber Spielraum für lokale Varianten lassen. In Estland erarbeitet jede Schule im Rahmen nationaler Vorgaben ihren eigenen Bildungsplan. Über die vom Staat und den lokalen Schulträgern bereitgestellten Mittel verfügt der jeweilige Schulleiter. Das Erziehungsministerium überwacht die Erfüllung der Vorgaben, berät gleichzeitig aber auch die Schulen dabei.
Der Bildungserfolg ist natürlich nicht nur durch die Schulautonomie erklärbar. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle. Deshalb gibt es auch Länder mit einer sehr hohen Schulautonomie und unterdurchschnittlichen Schülerleistungen (z. B. Tschechien, Slowakei und Island). Die Beispiele Estlands und Finnlands zeigen aber, dass eine hohe Schulautonomie auch einen hohen Leistungsstand beflügeln kann.
Fußnoten
Mehr interessante Themen
Digitalpotenzial #1: Theorie & Praxis
Chancen und Risiken des digitalen Zeitalters
Zeiten großen technologischen Wandels sind Zeiten großer Verunsicherung. Dies gilt auch für die Digitalisierung. Wir Menschen fürchten uns vor Massenarbeitslosigkeit und hyperintelligenten Maschinen, die unser Leben bestimmen. Technologischer Wandel bringt aber auch enorme Möglichkeiten und Chancen, die von der Angst vor Veränderung verdeckt
Digitalpotenzial #2: Arbeit
Die Arbeitswelt von morgen (und übermorgen)
Die Digitalisierung macht vielen Menschen Angst. Ein Großteil hat Sorge, durch neue Technologien den Job zu verlieren. Ein seriöser Blick auf die Zukunft der Arbeit zeigt aber, dass jede technologische Revolution neue, zusätzliche Arbeitsplätze hervorgebracht hat. Welche Veränderungen uns erwarten – und warum diese keineswegs nur negativ sei
Digitalpotenzial #3: Verwaltung
Was Österreich von Estlands digitaler Verwaltung lernen kann
Viele Staaten stehen dem Wunsch des Bürgers nach zeitgemäßen Dienstleistungen ratlos gegenüber. Estland, ein kleines Land im Baltikum, hat vorgemacht, wie digitale Verwaltung aussehen kann.
Digitalpotenzial #4: Bildung
Raus aus der Kreidezeit – neu denken lernen
Neue Technologien erfordern und ermöglichen ein neues Denken. Daraus ergeben sich auch neue Wege in der Bildung. Es wird Zeit, dass wir uns auf die Reise machen.