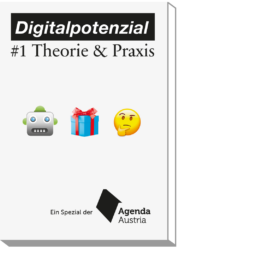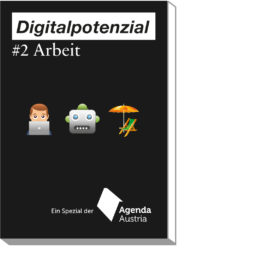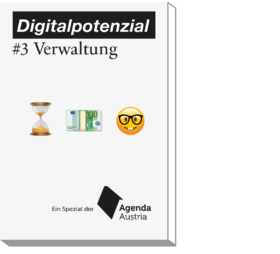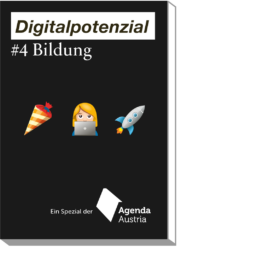Digitalpotenzial #2: Arbeit
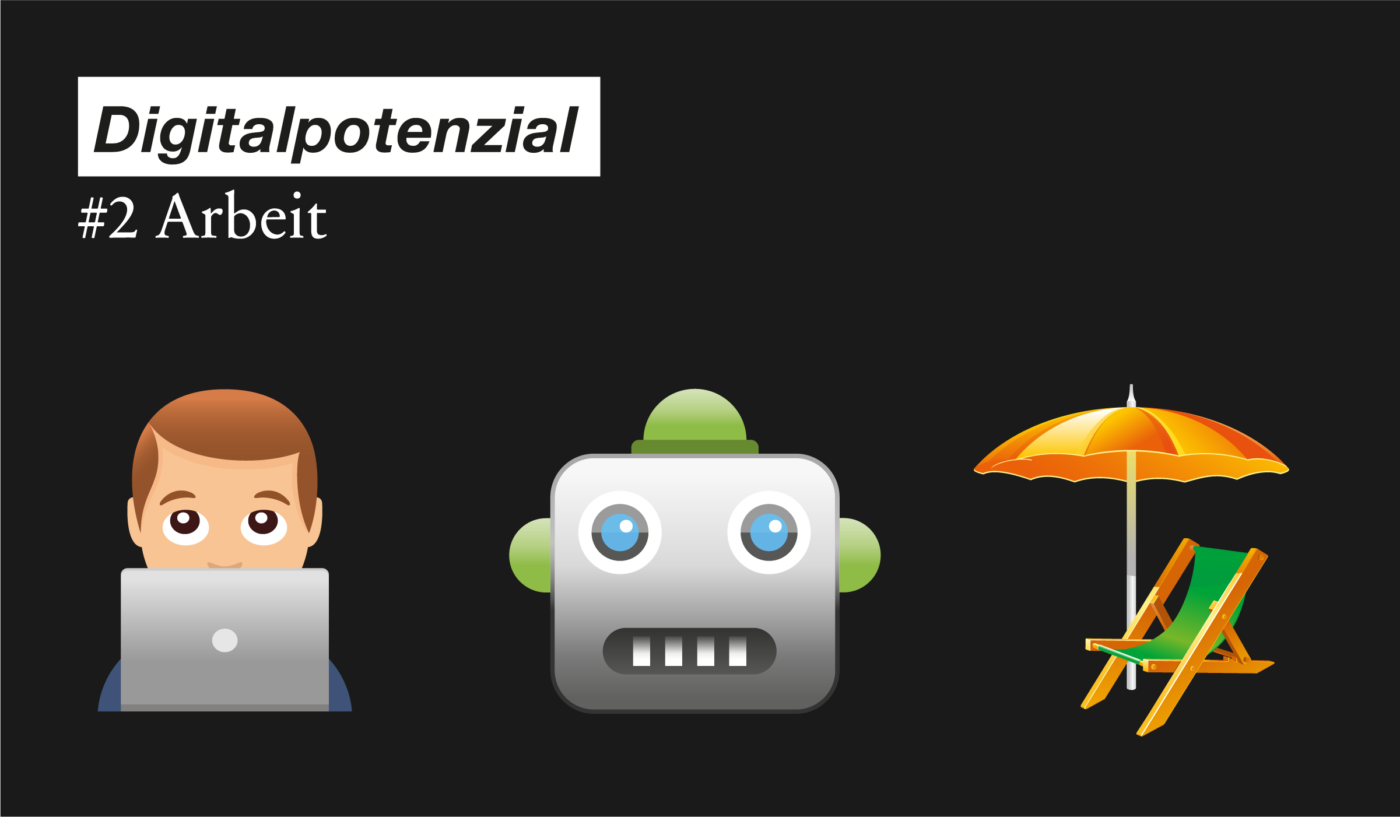
- 02.01.2019
- Lesezeit ca. 3 min
Die Arbeitswelt von morgen (und übermorgen)
Die Angst hat immer gute Konjunktur
Dass Berufe aussterben, ist nichts Neues. Die Geschichte zeigt aber, dass der Fortschritt nicht weniger Arbeit schafft, sondern mehr – gegen alle Widerstände.
Diesen optimistischen Blick auf die Vergangenheit muss man nicht teilen. Aber wir sollten zunächst verstehen, was hinter uns liegt, um uns den Herausforderungen von morgen stellen zu können. Das gilt auch für das Verhältnis von Mensch und Maschine. Bisher hat die Menschheit noch auf jede große technische Neuerung mit den schlimmsten Befürchtungen reagiert. Die dauerhafte Massenarbeitslosigkeit ist aber ausgeblieben. Dennoch sind einige Berufe von früher heute verschwunden – zum Beispiel der des Liftboys.
Die Aufgabe eines Liftboys war es, in Hotels oder Kaufhäusern den Fahrstuhl zu bedienen und Gästen oder Kunden beratend zu Seite zur stehen. Die Anfänge des Fahrstuhlführers liegen in der Gründungszeit der Grandhotels Ende des 19. Jahrhunderts. Auch an der Wiener Ringstraße leisteten sich gute Adressen diesen Service. Doch bereits in den 1970er-Jahren war das Metier des „Liftiers“ ein aussterbendes Gewerbe. Automatisierte Fahrstühle und personalisierte Ansagen in jedem Stockwerk machten den Liftboy überflüssig. Heute kennt man ihn nur noch aus Filmen.
Technologische Arbeitslosigkeit
Der Wettlauf zwischen Mensch und Technologie beschäftigt uns seit der Antike. Schon um Christi Geburt soll Kaiser Vespasian vom Einsatz kostensparender Transportmethoden abgeraten haben. Aus Sorge, dass sie Fuhrunternehmer arbeitslos machen könnten. Eine ähnlich skeptische Einstellung hatte auch Königin Elisabeth I. rund 1.500 Jahre später. Sie verweigerte dem britischen Vordenker William Lee das Patent auf seine Erfindung des Webstuhls. Sie hatte Angst, dass Tausende von Webern ihre Arbeit verlieren und auf der Straße landen könnten. Die Idee, dass Maschinen uns systematisch die Arbeit wegnehmen, formulierte der britische Ökonom John Maynard Keynes erstmals 1933 mit dem Begriff der technologischen Arbeitslosigkeit.[1] Doch entgegen seiner Vision von einer voll automatisierten Zukunft ist es bis zum heutigen Tag nicht zu einer Massenarbeitslosigkeit durch den technischen Fortschritt gekommen. Auch seine Vorstellung, dass seine Enkelkinder nur drei Stunden am Tag, also 15 Stunden die Woche, arbeiten würden, ist bisher nicht eingetreten.
Dem Schicksal des Liftboys könnte, wenn man Studien glaubt, im schlimmsten Fall jede zweite Arbeitskraft in den Industrieländern folgen. Eine derart düstere Prognose führt unweigerlich zur Suche nach Mitteln und Wegen, um die Menschen vor den Nebenwirkungen des technischen Fortschritts zu schützen. Ein populärer Vorschlag ist beispielsweise die Maschinen- oder Robotersteuer,[2] um durch Abgaben, die Besitzer von Maschinen leisten sollten, eine weitere Finanzierung des Sozialstaats sicherzustellen. International kursieren verschiedene Vorschläge zur Besteuerung von Robotern.[3] Bei einem Vergleich der Roboteranzahl in der Industrie und der Entwicklung der Beschäftigung lässt sich zwischen 1993 und 2007 kein signifikanter Zusammenhang erkennen.[4]
Der Widerstand gegen die „Macht der Maschinen“ ist nichts Neues, und oft verläuft er sogar ausgesprochen gewaltsam. Als im Jahr 1470 in Augsburg die ersten Bücher mit gedruckten Illustrationen erschienen, gingen die dort ansässigen Holzgraveure auf die Barrikaden.[5] Die Illustratoren fürchteten um ihre Arbeit und blockierten die Druckmaschinen – allerdings ohne Erfolg. Die Erfindung revolutionierte den Druck, die Nachfrage nach gedruckten Illustrationen schnellte in die Höhe. Der Beruf des Graveurs starb dabei aber nicht aus, sondern blühte erst richtig auf, denn irgendjemand musste die unzähligen neuen Drucktafeln ja mit Illustrationen versehen. Auch die Weber im britischen Nottingham standen der Automatisierung ihres Berufsstandes zu Beginn des 19. Jahrhunderts skeptisch gegenüber und zerstörten gezielt moderne Webstühle und Maschinen. Auch hier liefen die Bemühungen der „Technophobiker“ ins Leere – zum Glück, wie der Wirtschaftshistoriker Henry Hazlitt[6] festhielt: Denn Ende des 19. Jahrhunderts fanden mindestens einhundert Mal mehr Menschen in dieser Branche ihr Auskommen als noch zu Zeiten der Revolte.
Die Graveure von Augsburg und die Weber des vorindustriellen Englands stellten sich gegen den Wandel der Zeit, um wenig später festzustellen, dass ihnen der Fortschritt mehr Arbeit bescheren würde, als sie bewältigen konnten. Neue Technologien hatten ihre Berufe verändert, gemeinsam mit den Maschinen betraten sie ein neues Zeitalter.
Fußnoten
- Keynes (1933) ↩
- Kleine Zeitung (2017). ↩
- Mitha (2017). ↩
- International Labour Office (2016). ↩
- Economist (2017). ↩
- Ebenso beschreibt Hazlitt den eindrucksvollen Beschäftigungszuwachs durch die Einführung des Webstuhls: „Yet in 1787—twenty-seven years after the invention (Arkwright’s) appeared—a parliamentary inquiry showed that the number of persons actually engaged in the spinning and weaving of cotton had risen from 7,900 to 320,000, an increase of 4,400 percent." (Hazlitt 1978). ↩
Mehr interessante Themen
Digitalpotenzial #1: Theorie & Praxis
Chancen und Risiken des digitalen Zeitalters
Zeiten großen technologischen Wandels sind Zeiten großer Verunsicherung. Dies gilt auch für die Digitalisierung. Wir Menschen fürchten uns vor Massenarbeitslosigkeit und hyperintelligenten Maschinen, die unser Leben bestimmen. Technologischer Wandel bringt aber auch enorme Möglichkeiten und Chancen, die von der Angst vor Veränderung verdeckt
Digitalpotenzial #2: Arbeit
Die Arbeitswelt von morgen (und übermorgen)
Die Digitalisierung macht vielen Menschen Angst. Ein Großteil hat Sorge, durch neue Technologien den Job zu verlieren. Ein seriöser Blick auf die Zukunft der Arbeit zeigt aber, dass jede technologische Revolution neue, zusätzliche Arbeitsplätze hervorgebracht hat. Welche Veränderungen uns erwarten – und warum diese keineswegs nur negativ sei
Digitalpotenzial #3: Verwaltung
Was Österreich von Estlands digitaler Verwaltung lernen kann
Viele Staaten stehen dem Wunsch des Bürgers nach zeitgemäßen Dienstleistungen ratlos gegenüber. Estland, ein kleines Land im Baltikum, hat vorgemacht, wie digitale Verwaltung aussehen kann.
Digitalpotenzial #4: Bildung
Raus aus der Kreidezeit – neu denken lernen
Neue Technologien erfordern und ermöglichen ein neues Denken. Daraus ergeben sich auch neue Wege in der Bildung. Es wird Zeit, dass wir uns auf die Reise machen.