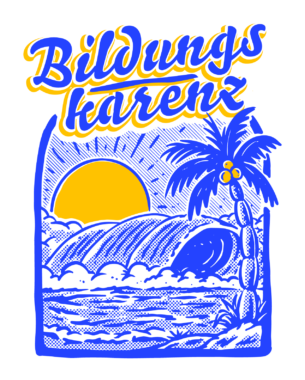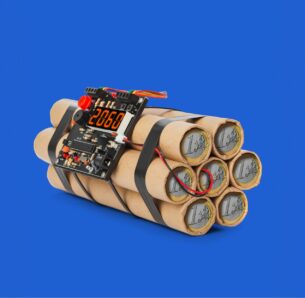Auswirkungen falscher Erwartungen auf die Evaluierung der Neuen Mittelschule
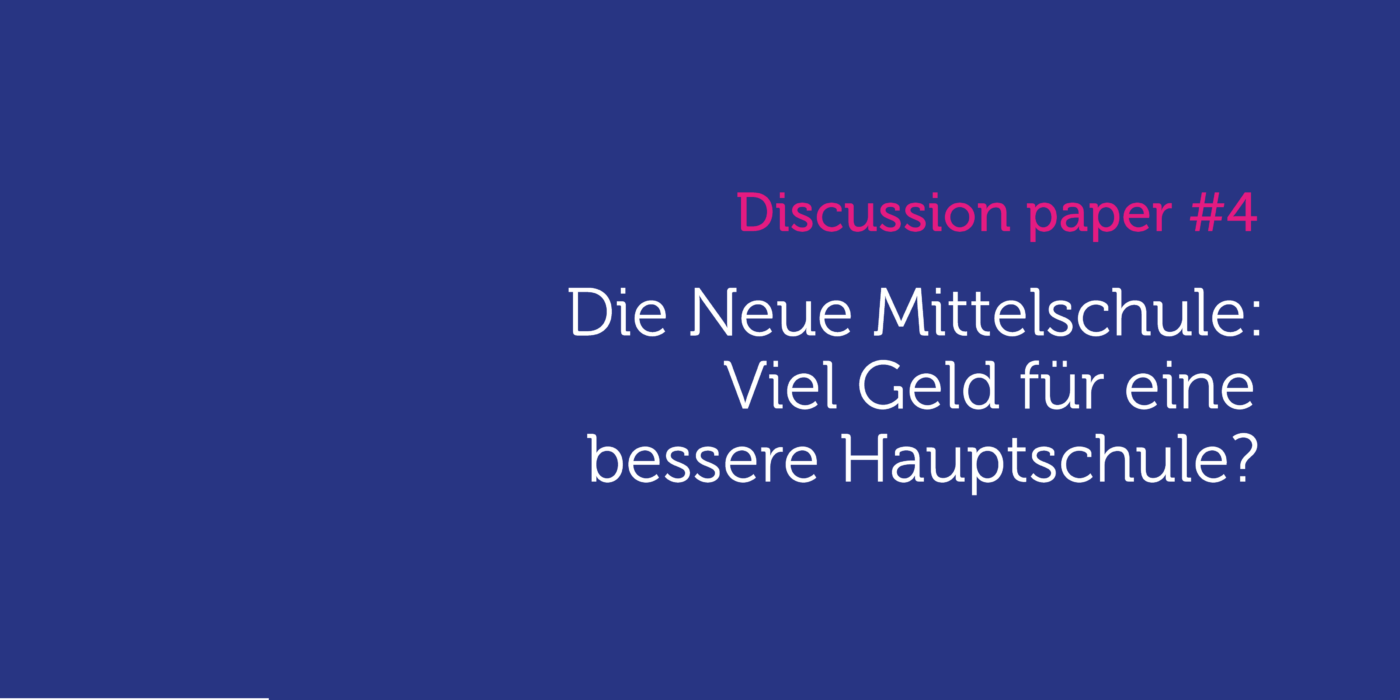
- 15.06.2015
- Lesezeit ca. 3 min
Viel Geld für eine bessere Hauptschule?
Die ausbleibende Korrektur der mit der Einführung der Neuen Mittelschule verbundenen Ziele und Erwartungen zeigte weitere Auswirkungen. Auch die gesetzlich vorgesehene wissenschaftliche Evaluierung wurde an jenen Zielen ausgerichtet, die gemäß dem anfänglichen Konzept vom neuen Schultyp erwartet wurden. Darunter an vorderster Stelle eine Verbesserung der Chancengleichheit:
„Durch Ausgleich von Nachteilen der Herkunft und bessere Förderung von Schülergruppen mit spezifischen Beeinträchtigungen sollen verbesserte Lernerfahrungen und eine Steigerung der Zugangsberechtigungen für weiterführende höhere Schulen erreicht werden“.[1]
Wenig überraschend kommt die Untersuchung der ersten beiden Jahrgänge der Neuen Mittelschule zur Feststellung, dass sich die Erwartungen hinsichtlich einer Verbesserung von Chancen- und Bildungsgerechtigkeit in keiner Weise erfüllt habe. Die Einführung der NMS, so die Wissenschaftler, habe nicht mehr Eltern dazu bewogen, durch die Entscheidung für eine NMS die frühzeitige Schulentscheidung zwischen Hauptschule und AHS aufzuschieben. Damit ist nichts anderes als die Tatsache angesprochen, dass jene Schüler, die die Wahlmöglichkeit zwischen NMS und AHS hatten, sich weiterhin für letztere entschieden haben. „In der NMS“, so das Ergebnis der Evaluierung, „zeigt sich im Modellvergleich keine relative Verbesserung der Situation der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler gegenüber der Situation vor Einführung der NMS“.[2]
Dieses Ergebnis war durch das Wegfallen des impulsgebenden Reformelements der gemeinsamen Schule in keiner Weise verwunderlich. In hohem Ausmaß verwunderlich ist hingegen die Tatsache, dass die Untersuchung und Bewertung der Frage nach mehr Chancengerechtigkeit durch die Neue Mittelschule in einer Weise behandelt wurde, als hätte es die faktische Veränderung der Ausgangsbedingungen (also die Parallelführung von AHS-Unterstufe und NMS) nie gegeben. Eine vorausschauende Vorgangsweise hätte bedeutet, nach dem parlamentarischen Beschluss zur parallelen Weiterführung der AHS sowohl die Konzeption wie die begleitende Rhetorik den neuen Gegebenheiten anzupassen. Nicht zuletzt hätten die ursprünglichen Ziele einer Verbesserung der Chancengleichheit wesentlich reduziert und die schulinternen wie die öffentlichen Erwartungshaltungen dementsprechend gedämpft werden müssen.
In der retrospektiven Betrachtung entsteht der Eindruck, die Reformverantwortlichen wären durch die Beibehaltung der ursprünglichen, mit hohen Erwartungen aufgeladenen Kommunikationsstrategie einer Art Selbstfesselungstrick erlegen. Trotz veränderter Ausgangsbedingungen wurde verbal an den hochgesteckten Zielen festgehalten. Damit ist die negative Bewertung der Reform durch die Evaluierung sowie die überzogene Verurteilung in der medialen Öffentlichkeit gleichsam selbst mitverursacht worden. Seither pendelt die öffentliche Debatte zwischen pauschaler Kritik in den verschiedensten Diskussionsforen und sozialen Netzwerken und einer unverdrossen positiv argumentierenden Ministerin, die lediglich geringen Korrekturbedarf sieht. Auf der Strecke bleibt dabei eine sachorientierte und die reale Faktenlage akzeptierende Diskussion über sinnvolle Konsequenzen aus den bisherigen Evaluierungsergebnissen und einer darauf aufbauenden Weiterentwicklung der Neuen Mittelschule.
Mehr interessante Themen
Welches Europa brauchen wir?
Kurz war der Traum vom geeinten Europa; der Glaube an ein regelbasiertes Miteinander im europäischen Haus, das mehr Wohlstand für alle produzieren würde, scheint passé. Die Visionen großer Europäer wie Jean Monnet oder Robert Schuman sind den Minderwertigkeitskomplexen kleiner Provinzpolitiker gewichen. Diese finden nicht mehr Freihandel und
Sozialer Wohnbau: Das Vermögen der (gar nicht so) kleinen Leute
Auch wenn es niemand glauben mag: Wohnen in Österreich ist vergleichsweise günstig. Die Wohnkostenbelastung der Haushalte beträgt im Schnitt rund 19 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit liegen wir im EU-Vergleich im Mittelfeld. Mieterhaushalte zahlen natürlich mehr als Eigentümer, aber mehr als drei Viertel von ihnen profitieren hierzula
Bildungskarenz: Ich bin dann mal weg!
Die Bildungskarenz war eine gute Idee, erfüllt aber nicht die von der Politik gesetzten Ziele – und wird immer teurer. An einer grundlegenden Reform führt kein Weg vorbei.
Die Schuldenbombe tickt: Wird Österreich das neue Italien?
Mehr als ein Jahrzehnt lang konnten sich Staaten kostenlos verschulden, die Zinsen lagen praktisch bei null. Damit sollten den Staaten Zeit erkauft werden, sich nach der Finanzkrise zu modernisieren. Statt diese Zeit aber für Reformen zu nutzen, wurde das vermeintliche Gratisgeld mit beiden Händen ausgegeben. Österreich muss seinen Ausgabenrausc
Was die Preise in Österreich so aufbläht
Die Inflation in Österreich hält sich hartnäckig. Fast acht Prozent waren es im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 werden vier Prozent vorhergesagt. Während viele andere Länder schon aufatmen können, ist die Inflationskrise für uns also noch nicht vorbei. Warum tut sich gerade Österreich so schwer? Wir prüfen drei Thesen.
Balken, Torten, Kurven Zweitausenddreiundzwanzig
Die Zeit der Lockdowns und Ausgangssperren war vorbei, die Wirtschaft zeigte sich nach den verheerenden Corona-Jahren in bester Laune, nur die hohe Teuerung hat uns die gute Stimmung verdorben (vom Finanzminister einmal abgesehen – der freute sich).