Zur Evaluierung der Neuen Mittelschule
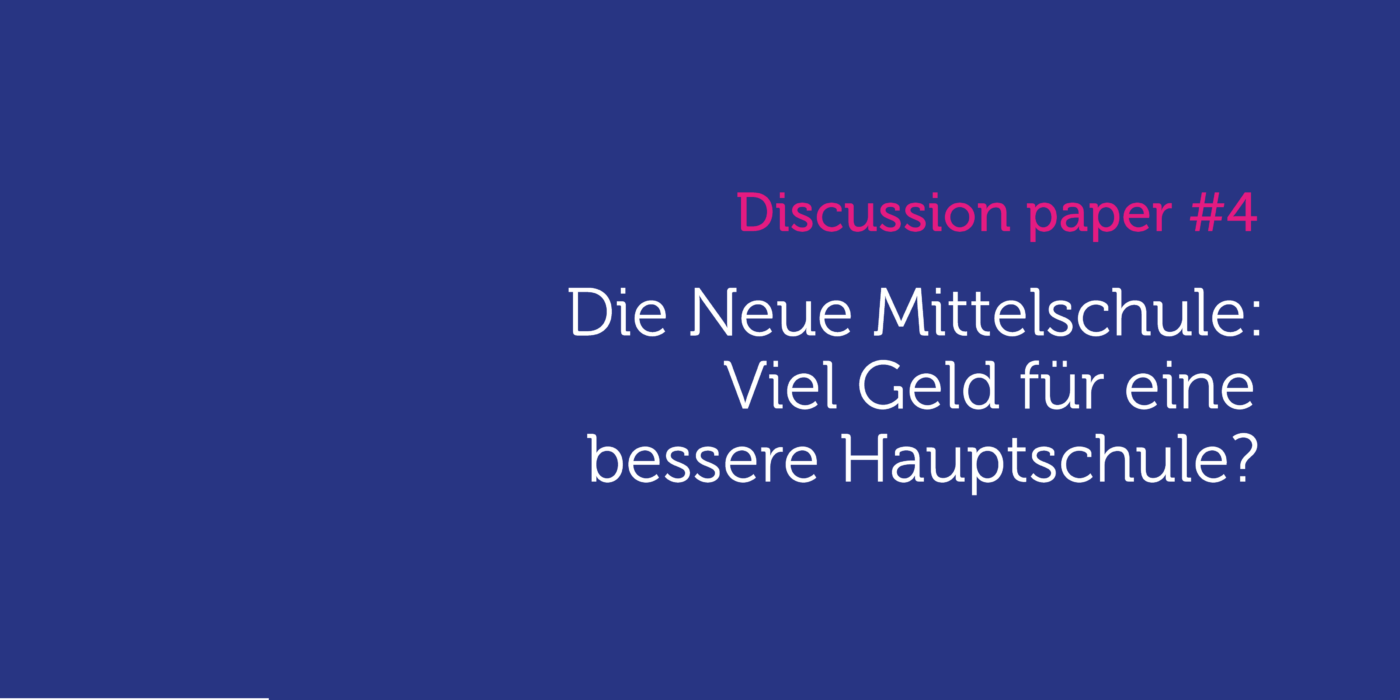
- 15.06.2015
- Lesezeit ca. 3 min
Viel Geld für eine bessere Hauptschule?
Parallel zur Ausweitung der Modellversuche wurde 2009 eine begleitende Evaluierung der ersten beiden Jahrgänge der Neuen Mittelschule durch das Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE) in Auftrag gegeben.
Die vom BIFIE erhobenen Daten[1] sowie weitere relevante Informationsquellen (Bildungsstandardüberprüfungen, etc.) wurden von einem Konsortium aus Erziehungswissenschaftlern, Pädagogen, Psychologen und Soziologen unter der Leitung des Salzburger Erziehungswissenschaftlers Ferdinand Eder ausgewertet und analysiert. In enger Zusammenarbeit mit dem BIFIE wurde ein umfangreicher Forschungsbericht sowie eine darauf basierende Zusammenfassung erstellt und im Februar 2015 veröffentlicht.[2]
Die mediale Berichterstattung stand in erstaunlichem Gegensatz zur differenzierten Darstellung des Evaluierungsberichts. Im Vordergrund der Kritik standen vor allem die nicht erreichten gesellschaftlichen Ziele einer Verbesserung der Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Also jene Ziele, die aufgrund des konzeptionellen Wunschdenkens entstanden waren, die aber wegen der Parallelführung von AHS-Unterstufe und NMS ohnehin nicht mehr zu erwarten waren. Aber vielleicht war das die unvermeidliche Konsequenz aus der überschießenden (Jubel-)Propaganda während der Einführung des neuen Schulmodells. Nun wurden die ersten Jahrgänge der Neuen Mittelschule an den ursprünglichen, utopischen Versprechungen gemessen und konnten in dieser Hinsicht nur enttäuschen.
Zugleich wurde in beinahe allen Berichten auf den Hinweis vergessen, dass sich die vorliegende Evaluierung lediglich auf die Anfangskohorten, also die ersten beiden Jahrgänge und somit auf die spezifische Konstellation der Startphase der Neuen Mittelschule bezieht. Die Standorte der ersten beiden Generationen der NMS unterscheiden sich wesentlich vom Durchschnitt der Hauptschulen: Sie weisen mehr Eltern mit geringer Schulbildung und wesentlich mehr Schüler mit Migrationshintergrund und daher nichtdeutscher Alltagssprache auf (22 Prozent statt 13 Prozent). Damit sind die Ergebnisse nur eingeschränkt für eine Gesamtbewertung der Neuen Mittelschule geeignet.
Eine weitere Begrenzung der Evaluierungsergebnisse ergibt sich durch die unterschiedliche Umsetzung des neuen pädagogischen Konzepts: In der ersten Generation haben etwa 61 Prozent der Klassen das Konzept intensiv und engagiert umgesetzt, in der zweiten Generation sank diese Quote auf etwa 37 Prozent.[3] Das hat zur Folge, dass die durchschnittlichen Ergebnisse (vor allem bei der zweiten Generation) natürlich ein leicht negativ verzerrtes Bild liefern. Denn dort, wo die Neuerungen nicht oder nur gering umgesetzt wurden, dürfen logischerweise auch keine positiven Effekte erwartet werden.[4]
Unter Berücksichtigung dieser Einschränkung der Aussagekraft der Evaluierung lassen sich die wichtigsten Ergebnisse folgendermaßen zusammenfassen:
- Positive oder zumindest leicht positive Ergebnisse werden im Bereich der Lernkultur erzielt, wobei sich bei jenen Schulen, die das NMS-Konzept intensiver umgesetzt haben, eine deutlichere Ausprägung der Effekte findet. Die NMS befinden sich „auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur (…), in der Individualisierung und Differenzierung eine wichtige Rolle spielen und die (…) generell mit einer Verbesserung der Unterrichtsqualität (…) verbunden ist.“[5]
- Ebenfalls positive und zum Teil starke Effekte lassen sich im Bereich der Schulkultur feststellen. Das Ausmaß erlebter und ausgeübter Gewalt ist nach Einführung der Neuen Mittelschule deutlich geringer, ebenso kommt es zu einem signifikanten Rückgang bei abweichendem Verhalten der Schüler.[6]
- Die Veränderungen der Kompetenzen im fachlichen Bereich fallen in den untersuchten Generationen unterschiedlich aus: Während bei der ersten Generation deutliche Verbesserungen in Mathematik und leichte Verbesserungen in Deutsch und Englisch feststellbar sind, wurden in der zweiten Generation lediglich geringe Verbesserungen in Deutsch und Englisch vermerkt. In Mathematik kam es in der zweiten Generation zu einer leichten Verschlechterung.[7] Beim Vergleich der Lesekompetenzen waren die Unterschiede nicht bedeutsam. Die Wissenschaftler sehen die Leistungszuwächse der ersten Generation allerdings als Ausdruck der spezifischen Ausgangssituation dieser Schulen sowie der Beteiligung besonders engagierter Lehrkräfte.
- Die Neue Mittelschule leistet keinen Beitrag zu mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit. Im Vergleich der Schülerleistungen zeigt sich keine Verbesserung der Situation der leistungsschwächeren Schüler gegenüber der Situation vor der Einführung der NMS.[8] Die Tendenz der Ergebnisse weist eher in die umgekehrte Richtung! Lediglich für Schüler mit nichtdeutscher Alltagssprache dürfte der Besuch einer NMS leichte Vorteile mit sich bringen.
- Eine Auswertung der Übertrittsraten von der Neuen Mittelschule in weiterführende höhere Schulen (AHS oder BHS) stellt eine geringfügige Verbesserung der Durchlässigkeit fest. Schüler der ersten Generation der NMS entschieden sich häufiger für eine höhere Schule, als das für vergleichbare Hauptschulen der Fall war.[9] Die Autoren sehen darin aber keinen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von Ungleichheit.
Das Konsortium für die Evaluierung der Neuen Mittelschule zieht für die Gesamtstruktur der Ergebnisse folgendes Resümee[10]:
”(1) Es gibt – im Vergleich zur Hauptschule – eine Reihe bedeutsamer Effekte im Bereich der pädagogischen Prozesse und des Schullebens insgesamt, die in die vom NMS-Konzept angestrebte Richtung weisen: Verbesserungen in der Gestaltung des Unterrichts, Rückgang an Gewalt in der Schule, Rückgang normabweichenden Verhaltens in Verbindung mit zumindest geringen Zunahmen im Wohlbefinden der Schüler und ihrem Engagement für die Schule.
(2) Diese veränderte und verbesserte Schul- und Lernumwelt wirkt sich jedoch nicht durchgehend und nicht konsistent in verbesserten Leistungen bzw. Zuwächsen im fachlichen und im überfachlichen Bereich aus. Insgesamt gibt es keine belastbaren Hinweise, dass das Niveau der NMS im Durchschnitt über jenem vergleichbarer Hauptschulen liegt. Vielmehr bestehen Zweifel, ob dieses an allen Standorten tatsächlich erreicht wird. Wohl aber zeigen sich in der ersten Generation der NMS bzw. in den „Modellklassen“, in denen das NMS-Konzept intensiver umgesetzt wurde, auch interpretierbare Leistungsverbesserungen.
(3) Erwartete Begleitfolgen der NMS hinsichtlich Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit treten nur teilweise ein: Die Wirkung der bekannten Ungleichheitsfaktoren – Geschlecht, familiäre Herkunft, unterschiedliches Leistungspotenzial der Schüler – unterscheidet sich nicht substanziell von jener in der Hauptschule. Für Schüler mit Migrationshintergrund könnte es hingegen ein kleiner Vorteil sein, eine NMS zu besuchen.”
Fußnoten
- In einer Eingangserhebung wurde die Lernausgangslage der NMS-Schüler erfasst, in einer Schlusserhebung die Situation am Ende der 8. Schulstufe erhoben und in einer Vergleichserhebung die letzten Abschlussklassen vor Einführung der Neuen Mittelschule befragt und getestet. ↩
- Eder u. a. (2015a) bzw. Eder u. a. (2015b). ↩
- Der Evaluierungsbericht spricht hier von Modell- und Plusklassen, die das Konzept zumindest „breit“ oder „relativ umfassend“ umgesetzt haben. ↩
- In der zusammenfassenden Präsentation des Ministeriums wurden die Ergebnisse der Modell- und Plusklassen gesondert ausgewiesen und dem Durchschnitt aller NMS-Klassen gegenübergestellt. ↩
- Eder u. a. (2015b), S. 16. ↩
- Allerdings kann das auch damit zusammenhängen, dass in den Anfangsgenerationen überproportional viele Schulen mit einem hohen Niveau an Gewalt teilnahmen. ↩
- In den „Modell- und Plusklassen“ fand in Mathematik keine Verschlechterung statt. ↩
- Wie in Abschnitt 6 besprochen, war dieses Ergebnis zu erwarten, nachdem die Neue Mittelschule zusätzlich und nicht an Stelle der AHS-Unterstufe etabliert wurde. ↩
- Im Vergleich zum Schuljahr 2007/2008 stieg die Übertrittsrate in der ersten Generation um ca. 5 Prozentpunkte, während sie im gleichen Zeitraum in einer Gruppe von Vergleichshauptschulen lediglich um ca. 1,7 Prozentpunkte anstieg. ↩
- Eder u. a. (2015b), S. 22. ↩
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





