Zum Bericht des Rechnungshofs über die NMS
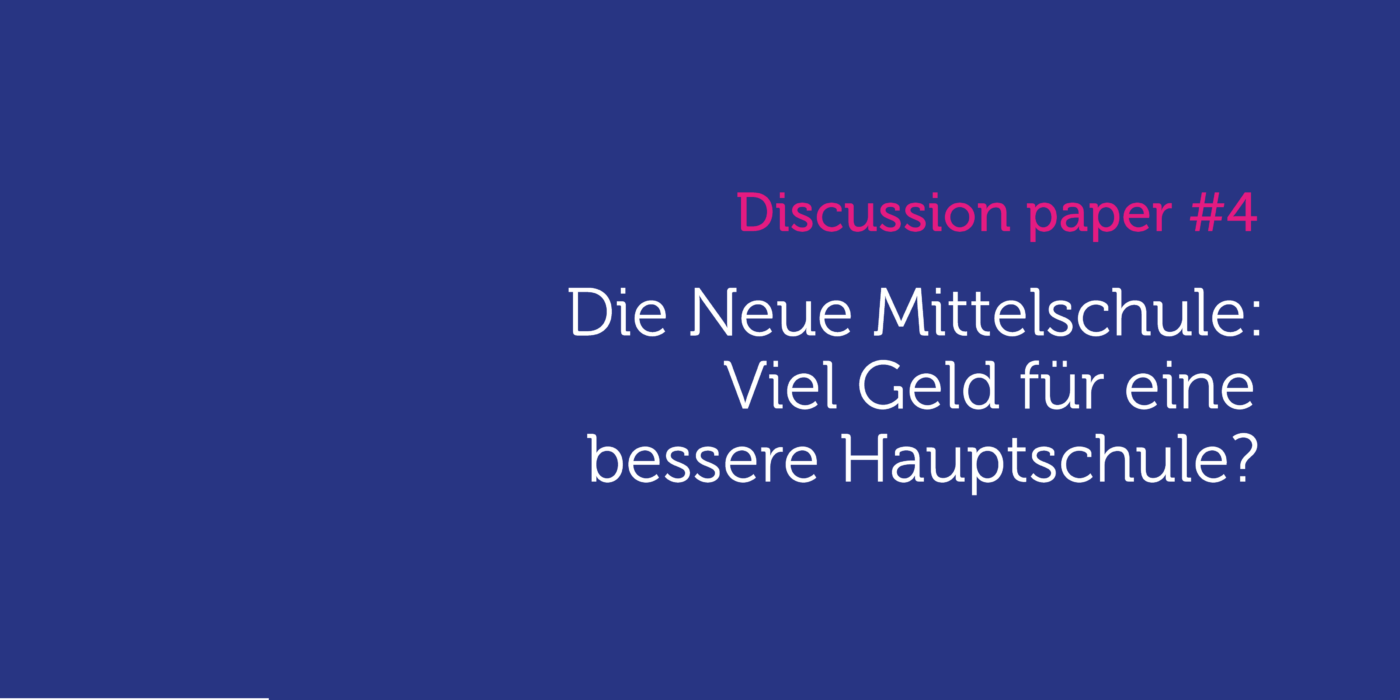
- 15.06.2015
- Lesezeit ca. 3 min
Viel Geld für eine bessere Hauptschule?
Der Rechnungshof prüfte vom November 2012 bis März 2013 die Modellversuche der Neuen Mittelschule der Schuljahre 2008/2009 bis 2011/2012.
Als wichtigste Kritikpunkte wurden genannt:
- Für die flächendeckende Einführung der Neuen Mittelschule in ganz Österreich ab 2012/2013 lagen keine zentralen Entscheidungsgrundlagen vor, da die Evaluierung noch nicht abgeschlossen war.
- Die geringe Beteiligung der AHS: Bis 2013 hatten sich bundesweit lediglich 11 AHS an Modellversuchen beteiligt.
- Das Unterrichtsministerium hatte Vergabevorschriften nicht eingehalten: Aufträge zur Durchführung des Projekts „eLearning“, zur Entwicklungsbegleitung und für die Öffentlichkeitsarbeit wurden ohne Wettbewerb bzw. teilweise ohne Ausschreibung vergeben.
- Laut Rechnungshof stiegen die durchschnittlichen Lehrerpersonalkosten von 6.600 Euro pro Schüler und Schuljahr an Hauptschulen auf rund 7.200 Euro pro Schüler und Schuljahr an Neuen Mittelschulen (berechnet für das Schuljahr 2011/2012). Die Lehrerpersonalkosten an AHS lagen dagegen im bundesweiten Durchschnitt bei 4.700 Euro.[1]
- Die Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit waren außergewöhnlich hoch: In drei Jahren (vom Herbst 2008 bis Herbst 2011) fielen rund 1,8 Mio. Euro für Öffentlichkeitsarbeit an, davon rund 1,09 Mio. Euro für Schaltungen in Printmedien.
- Die Organisation des Projekts Neue Mittelschule war zu komplex angelegt, erfolgte zu spät und musste mehrmals angepasst werden; die Koordination mit den Bundesländern war mangelhaft.
- Vorarlberg hielt die Mindestkriterien für die Einführung der NMS nicht ein (Abschaffung der Leistungsgruppen, gemeinsamer Einsatz von Bundes- und Landeslehrern). Das Ministerium insistierte zwar, genehmigte aber trotzdem alle Modellversuche. Auch die richtlinienwidrige Verwendung von Bundesressourcen für Kooperationsaktivitäten blieb ohne Konsequenzen.
- Ausführliche Kritik äußerte der Rechnungshof am verschränkten Einsatz von Bundes- und Landeslehrern. Die zersplitterte Kompetenzlage im Schulwesen erforderte sowohl bei der Planung als auch bei der Abrechnung aufwändige Verwaltungsabläufe: „Aufgrund des Auseinanderklaffens der Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung bei den Pflichtschulen (Hauptschulen) mussten neben den Schulleitungen der NMS–Modellversuche und der AHS/BHS sechs Abteilungen des Bundes und die Schulabteilungen der Länder tätig werden“.[2] Die vielfältigen dienst- und besoldungsrechtlichen Unterschiede zwischen Bundes- und Landeslehrern erschwerten den gemeinsamen Einsatz und zeigten die praktische Undurchlässigkeit zwischen beiden Lehrergruppen.
- Positiv wurde vermerkt, dass die Fort- und Weiterbildungsaktivitäten an Pädagogischen Hochschulen wesentlich erweitert wurden und sich die Anzahl der Teilnehmer vom Schuljahr 2009/2010 bis zum Schuljahr 2010/2011 verfünffachte.
Fußnoten
- Die Kritik des Rechnungshofes an den gestiegenen Lehrerpersonalkosten überrascht, denn diese waren Teil des Konzepts: Bereits in der Presseinformation zur legistischen Verankerung der NMS vom 1. März 2012 wird angekündigt: „ .... durch zusätzliche Ressourcen für jede Schulklasse, die budgetär abgesichert sind, bedeutet die Neue Mittelschule ... im Endausbau eine zusätzliche Investition in die Qualität des Unterrichts, in Individualisierung und Teamteaching von 1.000 Euro pro SchülerIn und Schuljahr“. BMUKK (2012), S.2. 13 ↩
- Rechnungshof (2013), S. 103. ↩
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





