Der Staat fördert. Alle.

- 22.03.2023
- Lesezeit ca. 2 min
Umgekehrt können Förderungen soziale Zwecke verfolgen, aber ökologisch fragwürdig sein, wie zum Beispiel die steuerliche Förderung von Pendlern oder die Strompreisbremse.[1]
Hinzu gesellen sich die ganz allgemeinen Probleme, die bei Förderungen immer auftreten können:
- Mitnahmeeffekte: Unternehmen beantragen Zuschüsse, obwohl sie eigentlich gar keine Hilfe brauchen würden. Das war zum Beispiel während der Corona-Krise der Fall. Auch beim Energiekostenzuschuss für energieintensive Unternehmen war das wieder zu beobachten, da Unternehmen ihn selbst dann beantragen konnten, wenn ihre Energiekosten nachweislich gerade einmal drei Prozent des Jahresumsatzes betrugen. Beim Energiekostenzuschuss 2 entfällt der Nachweis in vielen Fällen sogar.
- Substitutionseffekte: Aufgrund der preisverzerrenden Wirkungen von Förderungen können unternehmerische Entscheidungen aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ungünstig manipuliert werden. Dafür ist wieder der Energiekostenzuschuss ein Paradebeispiel: Durch die künstliche Verbilligung von Energie haben die Unternehmen nun weniger Anreize, in Maßnahmen zur Energieeinsparung oder zur Abkopplung von russischem Erdgas zu investieren, da sie nicht mehr den wahren Energiepreis zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen müssen. Da die künstlichen Preise suggerieren, dass Energie reichhaltiger zur Verfügung steht, als es tatsächlich der Fall ist, werden wünschenswerte Investitionen auf die lange Bank geschoben.
- Rent-Seeking: Wo der Staat Geld ausschüttet, sind offene Hände nie weit. Aber vor allem regulatorische Förderungen können dazu führen, dass Marktteilnehmer ohne eigenes Zutun Einkommen auf Kosten anderer erzielen, die sie bei Abwesenheit der Regulierung nicht bekommen hätten. Das kann zum Beispiel eine protektionistische Handelspolitik oder die restriktive Vergabe von Lizenzen für bestimmte Tätigkeiten sein. Der amerikanische Ökonom Gordon Tullock[2] hatte dieses Phänomen schon 1967 beschrieben und gezeigt, wie staatlich geschützte Monopole zulasten der Allgemeinheit profitieren können. Den Begriff Rent-Seeking prägte dann erst die spätere Vizegeneraldirektorin des IWF Anne Krueger[3] im Zusammenhang mit der Schutzwirkung von Importbeschränkungen auf heimische Produzenten. In Wien kommt in diesem Zusammenhang auch schnell wieder die Taxibranche in den Sinn, deren Angehörige gegen Wettbewerb von außen abgeschirmt werden. Die Kosten einer solchen Politik tragen die Konsumenten.
Wer verteilt das ganze Geld eigentlich?
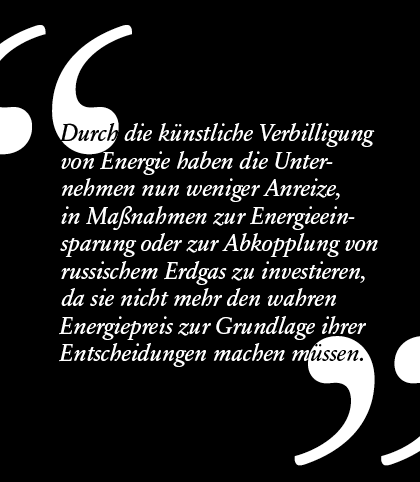 Förderungen können nicht nur hinsichtlich ihrer Art und Höhe problematisch sein. Auch ihre Durchführung über die beteiligten Förderinstitutionen kann besser oder schlechter funktionieren. Leider ist das österreichische System sehr komplex. Es besteht ein umfangreiches Geflecht aus Fördereinrichtungen, die wiederum von teils konkurrierenden Behörden oder Ressorts kontrolliert werden und damit dem Bund eine effiziente Förderpolitik – so schwer diese ohnehin zu erreichen ist – noch zusätzlich verkomplizieren. Auch für potenzielle Fördernehmer wird es so schwieriger, das richtige Angebot zu finden. Die Transparenzdatenbank sollte eigentlich auch hier Abhilfe schaffen; inwieweit sie es tut, ist sicher fraglich.
Förderungen können nicht nur hinsichtlich ihrer Art und Höhe problematisch sein. Auch ihre Durchführung über die beteiligten Förderinstitutionen kann besser oder schlechter funktionieren. Leider ist das österreichische System sehr komplex. Es besteht ein umfangreiches Geflecht aus Fördereinrichtungen, die wiederum von teils konkurrierenden Behörden oder Ressorts kontrolliert werden und damit dem Bund eine effiziente Förderpolitik – so schwer diese ohnehin zu erreichen ist – noch zusätzlich verkomplizieren. Auch für potenzielle Fördernehmer wird es so schwieriger, das richtige Angebot zu finden. Die Transparenzdatenbank sollte eigentlich auch hier Abhilfe schaffen; inwieweit sie es tut, ist sicher fraglich.
Eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) hat die Komplexität des Fördersystems in Österreich dargestellt. Anders als zum Beispiel in Deutschland, wo die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Zentrum der Förderpolitik steht und über die 16 Landesförderinstitute einen Großteil abdeckt, gibt es hierzulande eine Fülle von Institutionen. Diese werden zu allem Überfluss von verschiedenen Ressorts kontrolliert – manchmal sogar gleichzeitig. Die Komplexität führt dazu, dass in Krisensituationen keine Organisation zur Verfügung steht, die die schnelle Umsetzung eines Hilfsprogramms gewährleisten kann.
So musste in der Corona-Krise zum Beispiel die COFAG gegründet werden, weil man der aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH) die Umsetzung nicht zutraute. Zwei Jahre später wählt man aber doch die aws für die Umsetzung der Energiehilfen für Unternehmen und nutzt nicht die mühsam aufgebaute Kompetenz der COFAG.
Fußnoten
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





