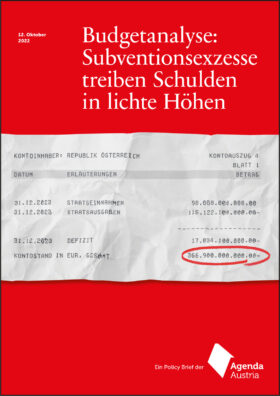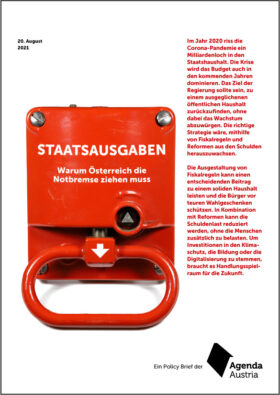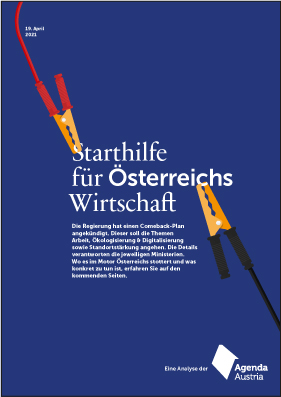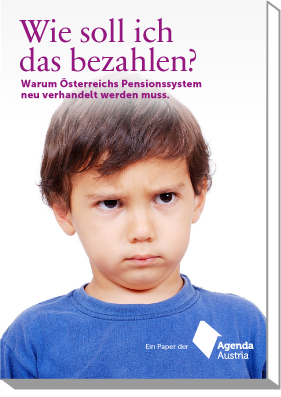Budget: Viel Geld, zu wenig Wille

- 29.01.2020
- Lesezeit ca. 3 min
Die am 07. Jänner 2020 angelobte Regierung hat viel vor. Die Koalition aus Volkspartei und Grünen hat auf 326 Seiten ihr Regierungsprogramm vorgelegt.
Viele Ziele sind ambitioniert, etwa die Klimaneutralität ab 2040 oder die Steuerentlastung in Richtung einer Steuer- und Abgabenquote von 40 Prozent der Wirtschaftsleistung. Diese Vorgaben werden das Budget beeinflussen und in einigen Fällen zu deutlichen Mehrausgaben oder Steuersenkungen führen. Die großen Ziele – ein ausgeglichener Haushalt, eine sinkende Steuerlast und Zukunftsinvestitionen – sollen aber gleichzeitig erreicht werden. Das ist aus heutiger Sicht ohne Einsparungen an anderen Stellen unrealistisch. Einschnitte im „System Österreich“, das durch ineffiziente föderale Strukturen, ein sehr teures Pensionssystem und einen Förderdschungel gekennzeichnet ist, sind aber gar nicht oder nur vage vorgesehen.
Im Jahr 2018 erzielte der Gesamtstaat erstmals seit 1974 einen Überschuss, für das Jahr 2019 wird der Bund erstmals seit 1954 mehr Geld eingenommen als ausgegeben haben. Dazu haben neben der guten Konjunktur die niedrigen Zinsen sowie ein strenger Budgetvollzug beigetragen. Die geringen Zinskosten entlasteten in den vergangenen Jahren das Budget massiv. Der Zinsaufwand für den Bund lag im Jahr 2013 noch bei sieben Milliarden Euro, war 2018 bereits um rund 1,5 Milliarden Euro niedriger und 2019 werden sich die Steuerzahler eine weitere halbe Milliarde an Zinsendienst erspart haben.
Handlungsempfehlungen
Demografiekosten dämpfen: Will die Regierung über die kommende Legislaturperiode hinaus das Ziel eines stabilen Haushalts absichern, wird man nicht umhinkommen, die Kostendynamik im Pensions-, Gesundheits- und Pflegebereich zu dämpfen. Das Pensionsantrittsalter sollte ab sofort jedes Jahr um zwei Monate ansteigen, bis das gesetzliche Pensionsantrittsalter bei 67 Jahren liegt. Danach sollte es an die Lebenserwartung gekoppelt werden.
Jo-Jo-Effekt abschaffen: Jahr für Jahr stellt die Inflation sicher, dass die Steuerlast selbst dann steigt, wenn real gar nicht mehr verdient wird. Diese steuerliche Mehrbelastung namens kalter Progression wird alle paar Jahre über eine Steuerreform zurückgegeben. Der Blick auf die Lohnsteuerbelastung lässt daher einen Jo-Jo-Effekt erkennen. Die Abschaffung der kalten Progression würde den Druck auf Strukturreformen erhöhen, die politische Vermarktung von Mini-Entlastungen erschweren und die Kaufkraft der Bevölkerung nachhaltig stärken.
Strukturreformen als Gegenfinanzierung: Die föderalen Strukturen des Landes und die damit einhergehende oft unübersichtliche Mittelverteilung treffen den Kern des österreichischen Budgetproblems. Sie müssen daher prioritär angegangen werden. In den Jahren 2020/21 wird etwa ein neuer Finanzausgleich verhandelt, der eine große Chance bietet, die Verantwortlichkeit von Finanzierung und Ausgaben einander anzunähern. Die Einsparungsmöglichkeiten durch Strukturreformen sind so groß wie drei Steuerreformen.
Ausgabenbremse anziehen: Damit künftig in guten Jahren regelmäßig Überschüsse anfallen, braucht es eine glaubwürdige und strenge Ausgabenbremse. Ein Überschussziel, festgelegt für einen ganzen Konjunkturzyklus, wie in Schweden, sorgt dafür, dass das Land in Krisenzeiten dennoch handlungsfähig bleibt. In Österreich sollte ein Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre den Ressorts die öffentlichen Gelder je nach Bedarf zuteilen.
Mehr interessante Themen
Budgetanalyse: Subventionsexzesse treiben Schulden in lichte Höhen
Mit Magnus Brunner (ÖVP) hält der nächste Finanzminister seine erste Budgetrede in turbulenten Zeiten. Im Bundesbudget sind dabei 68 Milliarden Euro an neuen Schulden für die Jahre 2022 bis 2026 vorgesehen. Nach der Pandemie ist es nun die anhaltende Teuerungswelle, die als Begründung für die hohen Ausgaben herhalten muss. Allerdings hätten
Staatsausgaben
Warum Österreich die Notbremse ziehen muss
Im Jahr 2020 riss die Corona-Pandemie ein Milliardenloch in den Staatshaushalt. Die Krise wird das Budget auch in den kommenden Jahren dominieren. Das Ziel der Regierung sollte sein, zu einem ausgeglichenen öffentlichen Haushalt zurückzufinden, ohne dabei das Wachstum abzuwürgen. Die richtige Strategie wäre, mithilfe von Fiskalregeln und Re
Starthilfe für Österreichs Wirtschaft
Die Regierung hat einen Comeback-Plan angekündigt. Dieser soll die Themen Arbeit, Ökologisierung & Digitalisierung sowie Standortstärkung angehen. Die Details verantworten die jeweiligen Ministerien. Wo es im Motor Österreichs stottert und was konkret zu tun ist, erfahren Sie auf den kommenden Seiten.
Wie soll ich das bezahlen?
Warum Österreichs Pensionssystem neu verhandelt werden muss
Unser Pensionssystem funktioniert, so lange die Zahl der Aktiven schneller wächst als jene der Pensionisten. Diese Zeiten sind vorbei. In dieser Arbeit geht es darum, den vielen jungen Menschen mehr Möglichkeiten zu geben, sich rechtzeitig und aktiv gegen den Gang in die Altersarmut zu schützen.
Türkis-Grün, die Farben der Veränderung?
Eine Analyse der Agenda Austria: Regierungsprogramm 2020 – 2024
Mit der folgenden Analyse gibt die Agenda Austria eine Einschätzung betreffend jene Themen des Regierungsprogramms ab, zu denen wir bereits eigene Studien und Empfehlungen erarbeitet haben.
Fünf Zutaten für eine bleibende Steuerreform
Obwohl Österreich international zu den Hochsteuerländern zählt, hat es sich in den letzten Jahren auch noch deutlich verschuldet. Die Agenda Austria schlägt fünf Maßnahmen für eine Steuerreform vor, um niedrige Steuern nachhaltig gegenzufinanzieren.