Arbeitsmarkt: Die Sünden der Vergangenheit
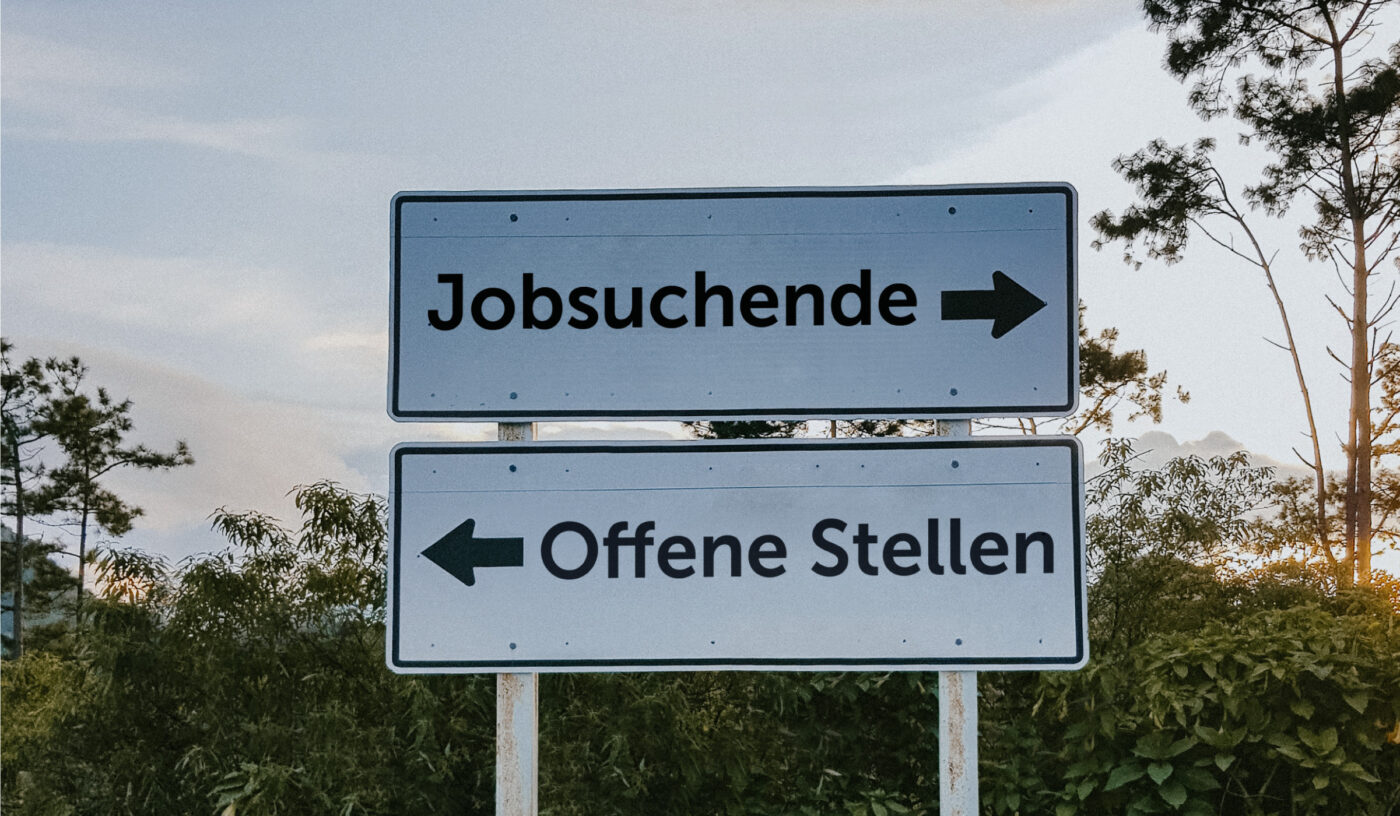
- 24.09.2021
- Lesezeit ca. 3 min
Wie die Qualifikation Arbeitssuchender zu stärken wäre
Wie gezeigt wurde, haben sehr viele Arbeitslose höchstens einen Pflichtschulabschluss. In einem modernen Industrie- und Dienstleistungsland wie Österreich ist eine Beschäftigung ohne entsprechende Qualifikation deutlich erschwert. Daher gilt: Je besser das jetzige Bildungssystem ist, desto weniger Handlungsbedarf, die Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern, gibt es später. Kommt es dennoch zu Qualifikationsdefiziten, so müssen diese zielgerichtet adressiert werden. So kann die Arbeitslosigkeit genutzt werden, um bereits begonnene Ausbildungskarrieren abzuschließen (abgebrochene Lehre, Studium etc.). Aber auch darüber hinaus ist Qualifikation ein zentrales Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik, um den Arbeitslosen die Teilnahme am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
- Profiling etablieren: Das bedeutet einerseits, dass die Fähigkeiten und Potenziale der arbeitssuchenden Person ermittelt werden müssen. Andererseits, dass der Arbeitsmarkt nach offenen Arbeitsplätzen abgesucht wird, die dem Profil des Arbeitssuchenden bestmöglich entsprechen. Dies erlaubt es, die Qualifizierung so zu gestalten, dass die Person optimale Chancen am Arbeitsmarkt hat. Dafür sollte auch auf computergestützte Programme zurückgegriffen werden.
- Technologien nutzen: Die Digitalisierung sollte auch stärkeren Einzug in die Arbeitsvermittlung und in die Betreuung der Arbeitslosen finden. Zum einen können die digitalen Wege verwendet werden, um einfacher, schneller und gegebenenfalls auch häufiger miteinander zu kommunizieren. Zum anderen sollten auch all die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz für die Arbeitsvermittlung genutzt werden. Es geht dabei nicht darum, den viel gescholtenen Algorithmus über Schulungen entscheiden zu lassen, sondern den Betreuer bei der Vermittlung zu unterstützen und ihn auch freizuspielen, damit er mehr Zeit hat, um sich zeitintensiveren Fällen besser widmen zu können.
- Deutschkenntnisse stärken: Sprach- und Lesekompetenz ist eine der wichtigsten Grundkompetenzen unserer Wissensgesellschaft und auch eine Voraussetzung für Weiterbildungen auf dem Arbeitsmarkt. Es gilt also, Sprachrückstände gar nicht erst entstehen zu lassen. Deshalb sollten gerade Kinder bildungsferner Familien so früh wie möglich Deutsch lernen. Bereits nach spätestens 36 Monaten sollte im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung eine Sprachstandsfeststellung mit Fokus auf die deutsche Sprache durchgeführt werden. Bei einer unzureichenden Sprachentwicklung sollten die Eltern zu Beratungsgesprächen verpflichtet und entsprechende Fördermaßnahmen besprochen und eingeleitet werden. Das Ergebnis dieser Sprachstandsfeststellung und die empfohlenen Fördermaßnahmen sollten der Ausgangspunkt einer durchgängigen Dokumentation der gesamten sprachlichen Entwicklung sein, die über alle Bildungsinstitutionen laufend überprüft und fortgeführt werden muss. Diese Dokumentation sollte neben einer Übersicht über alle Fördermaßnahmen auch Nachweise über die individuellen Lernfortschritte enthalten. Österreich braucht außerdem ein deutlich besseres Betreuungsangebot, vor allem für die unter Dreijährigen: flächendeckend, zuverlässig, flexibel und in hoher Qualität. Nicht zuletzt sollten gerade Eltern, die keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen, ebenfalls eine Betreuungsmöglichkeit mit entsprechender Sprachförderung bekommen.
Sollte trotz aller Bemühungen im Erwachsenenalter keine ausreichende Sprachkenntnis vorhanden sein, gilt es diese nach Möglichkeit zu verbessern. In einer durchorganisierten 20-Stunden-Woche sollten verpflichtend Sprachkurse absolviert werden.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





