Arbeitsmarkt: Die Sünden der Vergangenheit
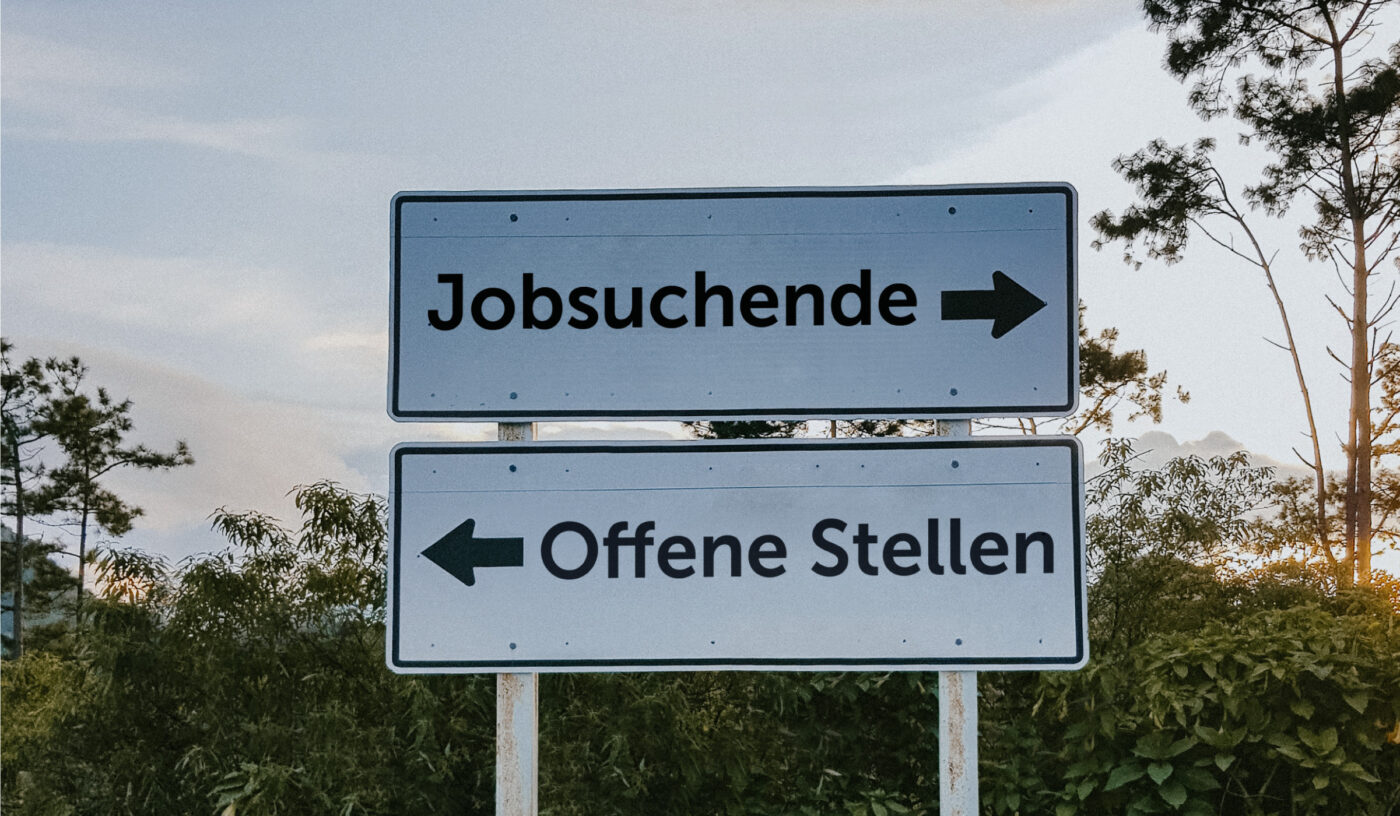
- 24.09.2021
- Lesezeit ca. 3 min
Was zu tun ist
Wie wir gesehen haben, ist die Gruppe der Langzeitarbeitslosen sehr heterogen. Daher sind unterschiedliche Wege der Unterstützung notwendig. Während für einen jungen Geringqualifizierten eine Umschulung das Richtige sein kann, braucht es bei fehlenden Sprachkenntnissen einen guten Deutschkurs. Ältere oder Menschen mit Kindern benötigen wiederum andere Formen der Hilfestellung. Den Langzeitarbeitslosen gibt es nicht. Darüber hinaus sollte der Staat finanzielle Anreize über staatlich geförderte Beschäftigungsformen setzen, damit Langzeitarbeitslosen die Rückkehr in Beschäftigung schneller und leichter gelingt.
Langzeitarbeitslosigkeit verhindern
Das beste Mittel, (Langzeit-)Arbeitslosigkeit zu reduzieren, ist, sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Besonders wichtig ist dies bei älteren Arbeitnehmern.
Daher sollte das Arbeitslosengeld so ausgestaltet sein, dass es zu Beginn der Arbeitssuche eine gute Absicherung bietet, mit zunehmender Dauer aber finanziell unattraktiver wird. Das Arbeitslosengeld sollte in den ersten 17 Wochen von derzeit 55 Prozent des Netto-Letztverdienstes auf 65 Prozent erhöht und dann schrittweise abgesenkt werden. So sollte die Nettoersatzrate in den nächsten 18 Wochen auf dem Niveau von 55 Prozent verharren und nach einer Gesamtbezugsdauer von 35 Wochen dann auf 45 Prozent absinken. Wer länger eingezahlt hat, muss auch länger anspruchsberechtigt sein. Damit steigen die Anreize, möglichst rasch einen Job zu finden. Im Idealfall, bevor die Person länger als ein Jahr arbeitslos ist.[1]
Das Arbeitslosengeld sinkt in fast allen europäischen Ländern mit der Dauer der Arbeitslosigkeit. Es erfolgt dabei meist auch ein Übergang von einem Versicherungssystem in ein Mindestsicherungssystem. Anders ist das in Österreich: Die Notstandshilfe zusammen mit dem Arbeitslosengeld garantiert ein zeitlich unbegrenztes Arbeitslosengeld auf fast unverändertem Niveau. Anders ausgedrückt: Österreich zahlt wenig Arbeitslosengeld, das dafür de facto ewig.
Wichtig: Eine Reform des Arbeitslosengeldes ist aber erst dann zielführend, wenn die coronabedingte Arbeitsmarktkrise überwunden ist. Alle Anreize helfen schließlich nicht, wenn keine ausreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Aber vorzubereiten ist die Reform bereits jetzt, damit sie bei Bedarf auch zur Verfügung steht.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen 'Abbildung 6: Arbeitslosenunterstützung im internationalen Vergleich
Verstärkt wird das Problem durch die sogenannte „Geringfügigkeitsfalle“. Gemeint ist, dass Arbeitslose bis zu 475 Euro im Monat dazuverdienen dürfen, ohne die Arbeitslosenunterstützung zu verlieren. Häufig wird die Geringfügigkeit als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt betrachtet. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Wer bis zur Geringfügigkeitsgrenze von 475 Euro brutto im Monat dazuverdient, kommt auf 6.650 Euro brutto im Jahr. Netto bleiben ebenfalls 6.650 Euro übrig. Wer aber 476 Euro dazuverdient, kommt netto auf 5.666 Euro im Jahr, verliert also 984 Euro. Obwohl das monatliche Bruttogehalt nur um einen Euro im Monat erhöht wurde. Die gesamten Arbeitskosten steigen für den Arbeitgeber jedoch um mehr als 1.300 Euro jährlich. Das Steuersystem verstärkt das Problem, da oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze Abgaben fällig werden, die den Nettolohn reduzieren. Zudem geht der Anspruch auf das Arbeitslosengeld verloren.
Damit Arbeitslose nicht durch die Geringfügigkeit von einer Vollanstellung abgehalten werden, sollte die Zuverdienstgrenze auf 200 Euro reduziert werden. Gleichzeitig sollten aber die finanziellen Eingliederungshilfen deutlich ausgeweitet werden, wenn diese Personen dennoch in Langzeitarbeitslosigkeit abrutschen (Details dazu unter „Mehr Geld fürs Arbeiten“).
One-Stop-Shop
Die Probleme in der Arbeitsvermittlung sind oftmals vielschichtig. Daher sollte ein intensiverer Austausch zwischen AMS und Arbeitssuchenden aufgebaut werden. Es sollten auch, wie bei Mitarbeitergesprächen üblich, Ziele vereinbart werden. Wie in Finnland sollte es eine zentrale Anlaufstelle für die Betroffenen geben, wo alle Informationen und Unterstützungen verschiedener staatlicher Stellen zusammenlaufen: Die Arbeitsvermittlung des AMS, die Gemeinde mit ihren Sozial- und Gesundheitsdiensten, die Sozialversicherung, die für die berufliche Rehabilitation verantwortlich ist, sowie Bildungseinrichtungen, die für Fort- und Weiterbildungsangebote zuständig sind. In Finnland arbeiten all diese Institutionen von einem Standort oder von einer mobilen Einrichtung aus eng zusammen.[2] Das ermöglicht es, zielgerichtet zu fördern und zu fordern.
Fußnoten
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





