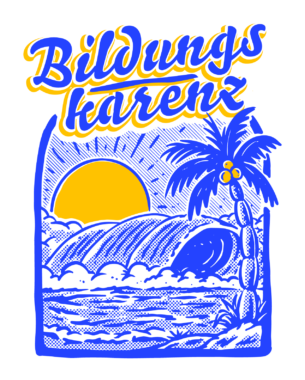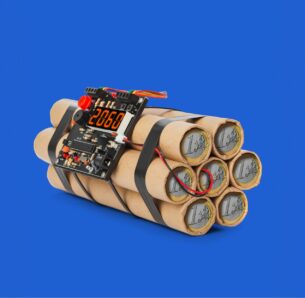Der digitale Euro

- 01.06.2021
- Lesezeit ca. 3 min
Freiheitskämpfer oder Kontrollfreak?
Welche Möglichkeiten der E-Euro bietet
Für die Geldpolitik stellt der E-Euro ein Mittel dar, wieder wirksamer zu werden. Denn das Zwei-Prozent-Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt seit Jahren in weiter Ferne. Hier haben digitale Zentralbankwährungen großes Potenzial. Je nach Ausgestaltung könnten sie genutzt werden, um Negativzinsen durchzusetzen – oder Zahlungen gezielt zu tätigen. Man stelle sich eine Welt vor, in der die Bürokraten der Notenbank in einer Krise entscheiden können, jedem Europäer mit Einkommensverlusten Geld gutzuschreiben – oder solchen mit Gewinnen Geld wegzunehmen.
Grundsätzlich könnten das Staaten bereits tun, man denke nur an die Wiener Gastronomiegutscheine, die an alle Wiener ausgehändigt wurden. Auch die EZB stellt bereits Unmengen an Liquidität zur Verfügung, damit Banken ausreichend Kredite an Unternehmen vergeben. Für Haushalte würde eine direkte Überweisung auf Knopfdruck mit dem E-Euro allerdings schneller und einfacher funktionieren. Denn jeder Bürger würde ein Konto für den E-Euro besitzen, aber nicht jeder Bürger besitzt ein Konto bei einer Bank. Zusätzlich unterscheidet sich das Guthaben auf dem Bankkonto von dem auf dem Konto des E-Euros. Denn das Geld auf dem Bankkonto beschreibt eine Schuld der Bank gegenüber dem Bürger. Der E-Euro beschreibt nur die Beziehung zwischen der Zentralbank und dem Bürger, ohne dass eine Bank zwangsläufig zwischengeschaltet werden müsste.
Neben der Preisstabilität wird die EZB sich an alle Vorgaben der europäischen Rechtsordnung halten müssen. Anders als in China muss in Europa die Nutzung der digitalen Währung zu Überwachungszwecken von vornherein ausgeschlossen werden, wenn man die Bevölkerung für den E-Euro begeistern will. Eine erste Befragung durch die EZB hat gezeigt, dass die Wahrung der Privatsphäre zum wichtigsten Thema bei der Einführung des E-Euro werden wird.[1]
Anders als private Alternativen müsste der E-Euro – wie Bargeld – überall akzeptiert werden. Zudem würde er die Möglichkeit bieten, Menschen ins Finanzsystem zu holen, die bisher gar kein Konto haben. Da ein E-Euro-Konto bei der EZB aber gratis sein müsste, hat das gewaltige Implikationen für Geschäftsbanken, die für die Kontoführung Gebühren verlangen. Auch könnte es im Extremfall zu einem „digitalen Bank-Run“ kommen, wenn Menschen ihr Geld von Geschäftsbanken abziehen und direkt bei der EZB bunkern, die ja per Definition nicht zahlungsunfähig werden kann.
Die Ersten in Europa (Schweden)
Die schwedische „e-krona“ befindet sich bereits in der Pilotphase. Grund für die rasche Einführung ist der starke Rückgang der Bargeldnutzung im Land. Kein Land in Europa ist der „bargeldlosen Gesellschaft“ näher als Schweden. Das hat auch negative Folgen, etwa hohe Verschuldung von privaten Haushalten oder Probleme für alte Menschen, Frauen und Migranten – allesamt Gruppen, die mehr Bargeld nutzen als der Durchschnitt.[2] Gemeinsam mit dem Unternehmen Accenture wird in Schweden nicht nur eine digitale Zentralbankwährung ausprobiert, sondern auch ein neues Zahlungssystem.[3] Schweden ist in einer ähnlichen Situation wie China: Die Notenbank hat das digitale Zahlungssystem den privaten Banken überlassen. Jetzt versucht man, die Kontrolle wieder zu gewinnen.
Die internationale Rolle des E-Euro
Ein digitaler Euro wäre nicht nur für die Bürger der Eurozone interessant. Er könnte in Ländern mit schwachen Währungen rasch zum gängigen Umlaufmittel werden. Etwa in der Türkei, wo die Regierung die Notenbank unter ihre Kontrolle gebracht hat, was zu hoher Inflation führt. Schon heute sind Euro und US-Dollar in einigen Ländern offizielle Währungen oder zumindest Orientierungspunkte in der Geldpolitik. Grundsätzlich ist es auch zu befürworten, dass durch internationalen Währungswettbewerb Währungen stabil gehalten werden. Trotzdem könnte es zu Instabilitäten auf den Finanzmärkten kommen, wenn die Bevölkerung eines Landes auf Knopfdruck aus einer Währung in eine andere flüchtet.
Ob und wie stark der E-Euro aber auch international genutzt werden kann, ist noch nicht fixiert. Aber zumindest innerhalb der Eurozone würden grenzüberschreitende Transaktionen effizienter und rascher werden. Eine Überweisung in ein anderes Land würde in Echtzeit funktionieren – und nicht Tage dauern. Die EZB sieht in der Einführung des E-Euro jedenfalls auch eine Schutzmaßnahme gegen die E-Währungen anderer Länder, etwa Chinas E-Yuan. Der Euro soll auf alle Fälle nicht an Bedeutung verlieren. Sollte es gelingen, einen demokratischen Gegenentwurf zu Chinas digitalen Währungsplänen zu liefern, könnte sein Stellenwert in der Welt wachsen.
Mehr interessante Themen
Welches Europa brauchen wir?
Kurz war der Traum vom geeinten Europa; der Glaube an ein regelbasiertes Miteinander im europäischen Haus, das mehr Wohlstand für alle produzieren würde, scheint passé. Die Visionen großer Europäer wie Jean Monnet oder Robert Schuman sind den Minderwertigkeitskomplexen kleiner Provinzpolitiker gewichen. Diese finden nicht mehr Freihandel und
Sozialer Wohnbau: Das Vermögen der (gar nicht so) kleinen Leute
Auch wenn es niemand glauben mag: Wohnen in Österreich ist vergleichsweise günstig. Die Wohnkostenbelastung der Haushalte beträgt im Schnitt rund 19 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit liegen wir im EU-Vergleich im Mittelfeld. Mieterhaushalte zahlen natürlich mehr als Eigentümer, aber mehr als drei Viertel von ihnen profitieren hierzula
Bildungskarenz: Ich bin dann mal weg!
Die Bildungskarenz war eine gute Idee, erfüllt aber nicht die von der Politik gesetzten Ziele – und wird immer teurer. An einer grundlegenden Reform führt kein Weg vorbei.
Die Schuldenbombe tickt: Wird Österreich das neue Italien?
Mehr als ein Jahrzehnt lang konnten sich Staaten kostenlos verschulden, die Zinsen lagen praktisch bei null. Damit sollten den Staaten Zeit erkauft werden, sich nach der Finanzkrise zu modernisieren. Statt diese Zeit aber für Reformen zu nutzen, wurde das vermeintliche Gratisgeld mit beiden Händen ausgegeben. Österreich muss seinen Ausgabenrausc
Was die Preise in Österreich so aufbläht
Die Inflation in Österreich hält sich hartnäckig. Fast acht Prozent waren es im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 werden vier Prozent vorhergesagt. Während viele andere Länder schon aufatmen können, ist die Inflationskrise für uns also noch nicht vorbei. Warum tut sich gerade Österreich so schwer? Wir prüfen drei Thesen.
Balken, Torten, Kurven Zweitausenddreiundzwanzig
Die Zeit der Lockdowns und Ausgangssperren war vorbei, die Wirtschaft zeigte sich nach den verheerenden Corona-Jahren in bester Laune, nur die hohe Teuerung hat uns die gute Stimmung verdorben (vom Finanzminister einmal abgesehen – der freute sich).