Handlungsempfehlungen
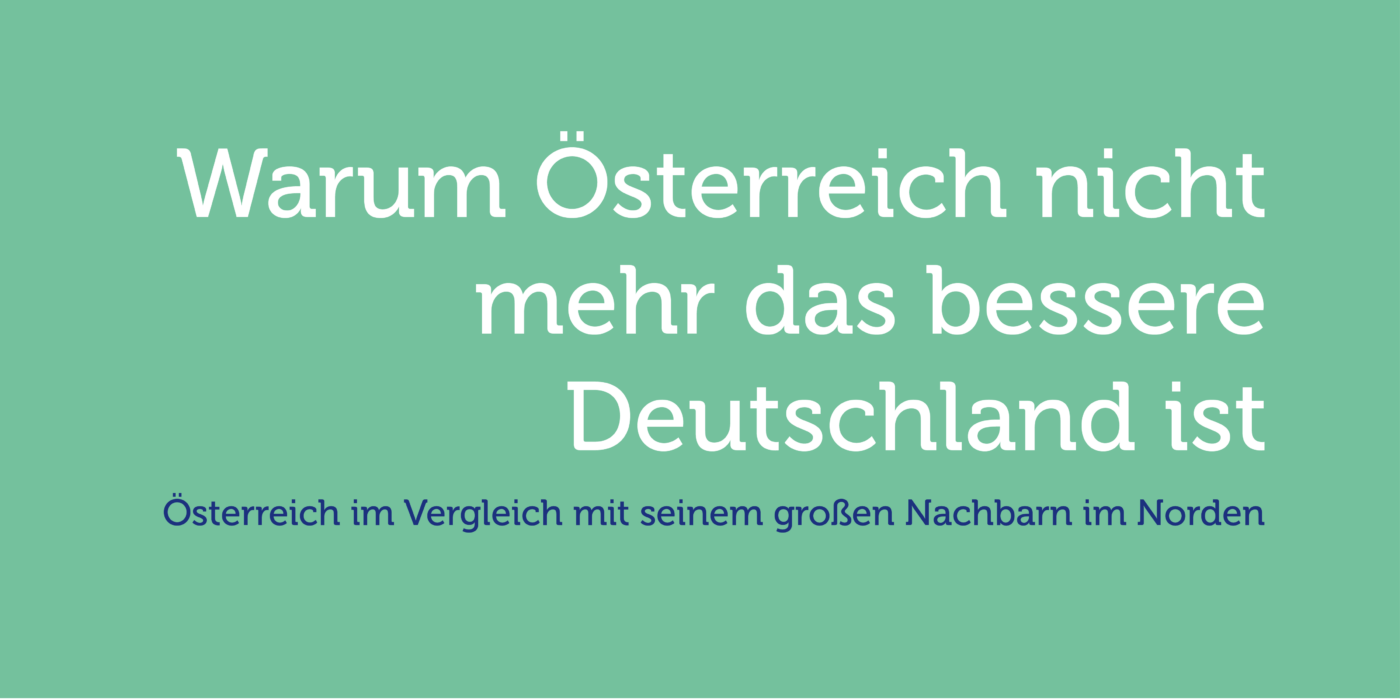
- 17.07.2017
- Lesezeit ca. 1 min
Österreich im Vergleich mit seinem großen Nachbarn im Norden
- Dezentralisierung des Kollektivvertragssystems
Die Dezentralisierung des Kollektivvertragssystems auf der untersten Ebene war einer der entscheidenden Gründe, warum deutsche Unternehmen gegenüber der osteuropäischen Konkurrenz wettbewerbsfähig blieben. Ein weiterer Grund war die Möglichkeit einer flexiblen Anpassung der Arbeitsverträge (dabei immer in Abstimmung mit dem Betriebsrat). Vor allem über die Krise hinweg erwies sich dieses Modell als stabil und flexibel.
- Höheres Arbeitslosengeld, dafür zeitlich gestaffelt
Die in Deutschland geltende zeitliche Staffelung des Arbeitslosengeldes wäre auch für Österreich sinnvoll. Hierfür könnte die Ersatzrate zu Beginn der Arbeitslosigkeit höher ausfallen und würde über die Zeit allmählich abgesenkt werden. Jeder sollte eine angemessene Zeit für die Jobsuche zur Verfügung haben. Allerdings würde durch das Absin- ken der Ersatzrate auch signalisiert werden, dass man nicht zu lange vom Arbeitsmarkt fernbleiben sollte, weil dadurch die Attraktivität als Arbeitnehmer für die Unternehmen sinkt.
- Sozialleistungen zusammenlegen
Die unterschiedlichen Mindestsicherungssysteme auf Länderebene führen derzeit nicht nur zu einem uneinheitlichen System der sozialen Sicherung, sondern auch zu entsprechender Intransparenz. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS), die Notstandshilfe und das Arbeitslosengeld sind bei einer zentralen Stelle nach deutschem Vorbild zusammenzulegen. Auf diese Weise könnte für eine klare Kompetenzstruktur und Zuständigkeit gesorgt und der bürokratische Aufwand gesenkt werden. Zudem können die Ansprüche auf Sozialleistungen und die verpflichtende Bereitschaft zur Teilnahme am Arbeitsmarkt besser überprüft werden.
- Arbeitsanreize erhöhen
In Österreich liegt die Mindestsicherung (inklusive Transfers) von Familien mit Kindern oft deutlich über dem üblichen Lohneinkommen eines Familienmitglieds. Dies geht oftmals zulasten der Bereitschaft, eine bezahlte Tätigkeit aufzunehmen. Um die Arbeitsanreize zu erhöhen, ist die Deckelung von Leistungen oder die stärkere Umstellung auf Sachleistungen ratsam. Ziel aller Veränderungen in diesem Bereich sollte sein, dass Bezieher von Sozialleistungen möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Senkung der Sozialversicherung um einen Prozentpunkt und die Abschaffung des Wohnbauförderungsbeitrags würden den Arbeitsanreiz erhöhen. Für einen Niedrigverdiener (1.500 Euro) würde das jährlich knapp 300 Euro netto mehr auf dem Konto bedeuten. Zusammen wäre das ein Anstieg des jährlichen Nettolohns von Niedrigverdienern um fast zwei Prozent. Somit erhöht sich auch der Unterschied zwischen Sozialleistungen und Arbeitseinkommen (netto) spürbar.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





