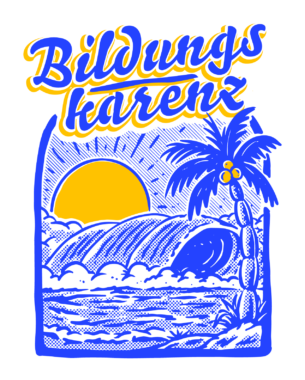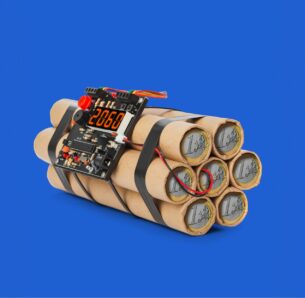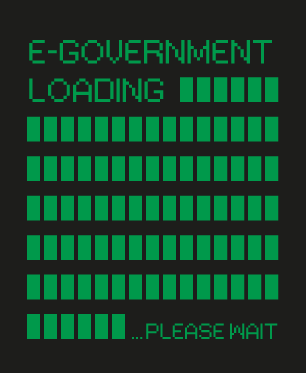Die Oxfam-Methode
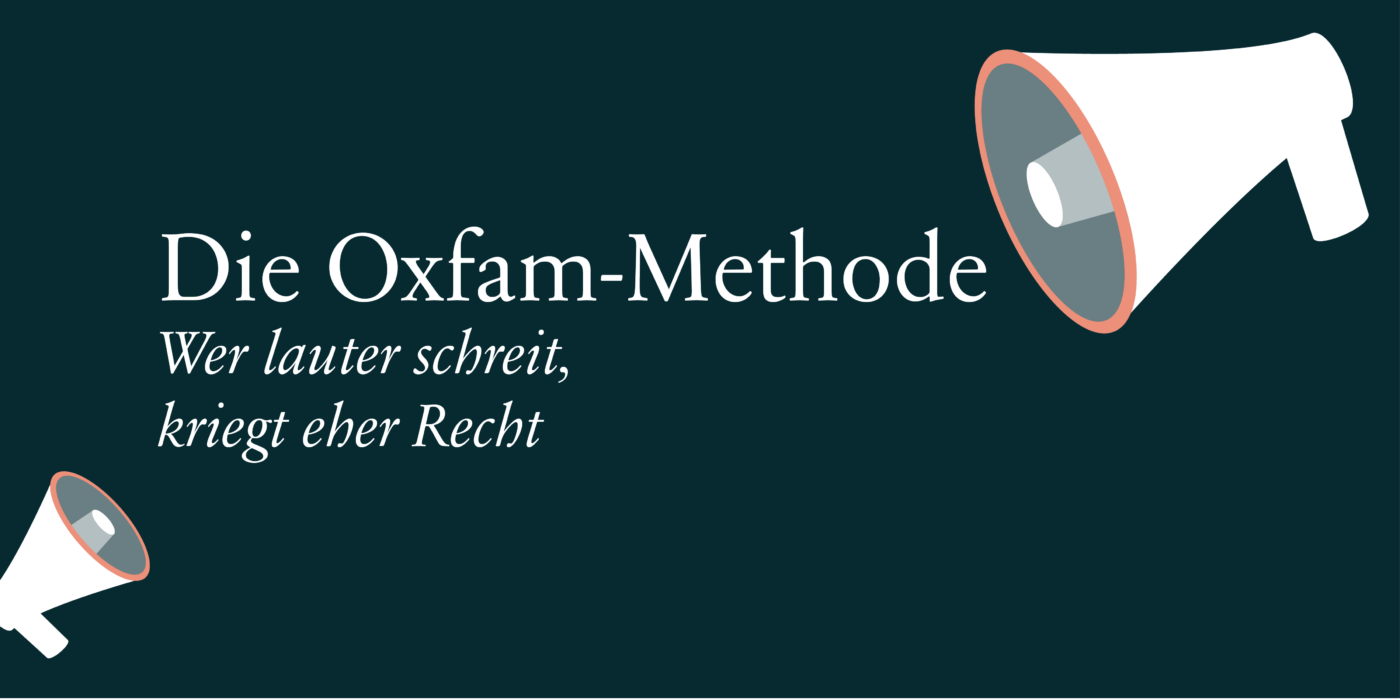
- 16.01.2017
- Lesezeit ca. 2 min
Wer lauter schreit, kriegt eher Recht
[null]Jedes Jahr, pünktlich vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos, versendet Oxfam eine neue Studie zur Ungleichheit in der Welt. Im Ergebnis steht die Botschaft, dass es auf der Welt sehr ungerecht zugeht. Und was noch wesentlicher ist: Es wird von Jahr zu Jahr auch noch schlimmer. Der internationale Verbund verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen löst damit – auch jedes Jahr – eine beachtliche Schock- und Empörungswelle in den Medien und in der Bevölkerung aus:
“Our newest piece of research (…) has received a lot of attention around the world, including coverage by the Economist, CNN, the BBC, etc”[1]
– Ricardo Fuentes-Nieva, Leiter der Forschungsabteilung von Oxfam International
Und so titelte auch letztes Jahr die österreichische Tageszeitung „Kurier“:
„Den 62 Reichsten gehört die halbe Welt“[2], ein Standard-Kommentar stellte fest: „Oxfam-Studie zu Superreichen: Jedes Maß verloren“,[3] und der damalige Bundesgeschäftsführer der SPÖ, Gerhard Schmid, nutzte die Oxfam- Studie als Anlass zu einer Brandrede für mehr Verteilungsgerechtigkeit und gegen den eigenen Koalitionspartner.[4]
Die Botschaft, die viele Kommentatoren aus den Oxfam-Reports der letzten Jahre herauslasen, war eindeutig: Das kapitalistische Wirtschaftssystem und die fortschreitende Globalisierung schaffen weltweit große Ungleichheit und damit inakzeptable Ungerechtigkeit. Mehr noch: Der große Reichtum einiger weniger Superreichen geht auf Kosten der vielen Armen in der Welt – sie werden durch die enorme Ungleichheit noch viel länger in Armut gehalten, als das bei gerechteren Verhältnissen der Fall wäre. Oder anders formuliert: Die Reichen werden immer reicher, weil die Armen arm gehalten werden.
Oxfam stimmt damit ein in den vielstimmigen Chor all jener, die behaupten, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden.
So ist es zum Glück aber nicht. In den letzten 35 Jahren ist die Zahl der nach der Weltbank-Definition in Armut lebenden Menschen um über eine Milliarde oder fast zwei Drittel zurückgegangen.[5] Gleichzeitig stieg die Weltbevölkerung um etwa 3 Milliarden Menschen an, gerade in den ärmeren Regionen. Die Armutsrate (Anteil der Personen, die in Armut leben, gemessen an der Gesamtbevölkerung) ist von über 44 Prozent im Jahr 1981 auf unter zehn Prozent im Jahr 2015[6] gesunken. Das ist eine höchst erfreuliche Entwicklung.
Warum gelingt es dann einer Organisation wie Oxfam, begleitet von vielen weiteren globalisierungskritischen NGOs, einen Medienhype auszulösen, der diese Tatsachen offensichtlich bewusst ignoriert? Mehr noch: Die Dynamik der Globalisierung, die in vielen Entwicklungsländern zu einer bedeutenden Verbesserung der Lebensumstände der ärmsten Bevölkerungsschichten geführt hat, wird in ihr Gegenteil verkehrt. Die Globalisierung wird zum Sündenbock für den tatsächlich noch immer vorhandenen Restbestand an extremer Armut gemacht. Und welche Zwecke verfolgt eine Organisation wie Oxfam, die an anderer Stelle, in einer Werbebroschüre für die eigenen Aktivitäten, schreibt: „Es ist kaum zu glauben, aber der Anteil der Weltbevölkerung, der von weniger als 1,25 Dollar am Tag lebt, hat sich in den letzten 15 Jahren halbiert.“[7]
Mit dem vorliegenden Beitrag will die Agenda Austria zur Versachlichung einer emotional geführten Debatte um die Armut in der Welt und die Möglichkeiten ihrer Beseitigung beitragen und dabei einige grundsätzliche Feststellungen treffen.
Fußnoten
- Ricardo Fuentes-Nieva, „On wealth, debt and inequality – in response to some criticism“, Blogbeitrag nach der Kampagne 2015 vom 26.01.2015. ↩
- Den 62 Reichsten gehört die halbe Welt“, in: kurier.at vom 18. Jänner 2016. ↩
- Oxfam-Studie zu Superreichen: Jedes Maß verloren“, in: Der Standard vom 18. Jänner 2016. ↩
- SPÖ-Pressedienst vom 18.01.2016. ↩
- Global Monitoring Report (2016). ↩
- Prognose der Weltbank. ↩
- Oxfam (2015). ↩
Mehr interessante Themen
Sozialer Wohnbau: Das Vermögen der (gar nicht so) kleinen Leute
Auch wenn es niemand glauben mag: Wohnen in Österreich ist vergleichsweise günstig. Die Wohnkostenbelastung der Haushalte beträgt im Schnitt rund 19 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit liegen wir im EU-Vergleich im Mittelfeld. Mieterhaushalte zahlen natürlich mehr als Eigentümer, aber mehr als drei Viertel von ihnen profitieren hierzula
Bildungskarenz: Ich bin dann mal weg!
Die Bildungskarenz war eine gute Idee, erfüllt aber nicht die von der Politik gesetzten Ziele – und wird immer teurer. An einer grundlegenden Reform führt kein Weg vorbei.
Die Schuldenbombe tickt: Wird Österreich das neue Italien?
Mehr als ein Jahrzehnt lang konnten sich Staaten kostenlos verschulden, die Zinsen lagen praktisch bei null. Damit sollten den Staaten Zeit erkauft werden, sich nach der Finanzkrise zu modernisieren. Statt diese Zeit aber für Reformen zu nutzen, wurde das vermeintliche Gratisgeld mit beiden Händen ausgegeben. Österreich muss seinen Ausgabenrausc
Was die Preise in Österreich so aufbläht
Die Inflation in Österreich hält sich hartnäckig. Fast acht Prozent waren es im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 werden vier Prozent vorhergesagt. Während viele andere Länder schon aufatmen können, ist die Inflationskrise für uns also noch nicht vorbei. Warum tut sich gerade Österreich so schwer? Wir prüfen drei Thesen.
Balken, Torten, Kurven Zweitausenddreiundzwanzig
Die Zeit der Lockdowns und Ausgangssperren war vorbei, die Wirtschaft zeigte sich nach den verheerenden Corona-Jahren in bester Laune, nur die hohe Teuerung hat uns die gute Stimmung verdorben (vom Finanzminister einmal abgesehen – der freute sich).
E-Government: „Hobn’S kan Ausweis?“
Die öffentliche Verwaltung soll digitalisiert werden. Das verspricht die Politik seit Jahren. Diverse Angebote gibt es bereits, doch der große Durchbruch wollte bisher nicht gelingen. Das liegt nicht nur an der Regierung. Auch die Bürger müssten, im eigenen Interesse, etwas mehr Bereitschaft zur Veränderung aufbringen.