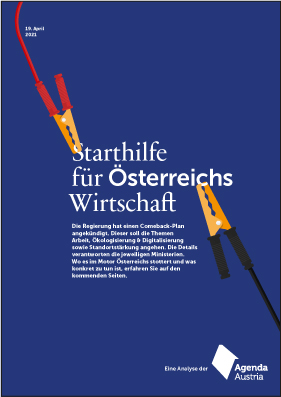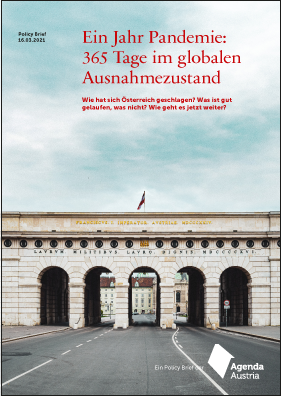Wie Homeschooling funktionieren kann

- 13.08.2020
- Lesezeit ca. 3 min
Im Home-Office wurden Eltern zu Hilfspädagogen, mit erheblichen Folgen für die Wirtschaft. Der Sommer sollte genutzt werden, um zumindest einen Schul-Notbetrieb im Herbst zu ermöglichen.
Die Schließung der Schulen während der Corona-Pandemie hatte weitreichende Folgen – für die Eltern, die Kinder und die Wirtschaft. Fast zwölf Prozent aller in diesem Zeitraum normalerweise angefallenen Arbeitsstunden sind betroffen, weil Eltern im „Homeschooling“ mit dem Unterricht ihrer Kinder beschäftigt waren. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Bis zu 121 Millionen produktiver Arbeitsstunden dürften den acht Wochen Schulschließung zum Opfer gefallen sein. Das entspricht rund 7,2 Milliarden Euro an Wertschöpfung oder knapp zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Von den Schulschließungen betroffen waren rund 1,3 Millionen Kinder unter 15 Jahren. Ein normaler Unterricht war für sie nicht möglich. Sie müssen wegen des verlorenen Lernfortschritts in der Zukunft mit Gehaltseinbußen rechnen. Die Nachwirkungen der Corona-Krise werden wir also auch Jahrzehnte später noch spüren.
Bedauerlich ist es, dass das österreichische Bildungssystem trotz oftmals angekündigten Masterplänen zur Digitalisierung völlig unvorbereitet getroffen wurde. Nun können die Defizite der vergangenen Jahre nicht in einem Sommer aufgeholt werden, dennoch gilt es für den Herbst einen Unterricht durchführen zu können, auch wenn es zu Schulschließungen kommt. Trotz erster Schritte, die mit dem „8-Punkte-Plan“ gesetzt wurden, ist es höchst fraglich, ob die Vorbereitungen einen Betrieb selbst mit vereinzelten Schulschließungen gewährleisten. Nun mag man hoffen, dass es zu keinen weiteren Einschränkungen im Unterricht kommen wird. Es ist allerdings auch die Aufgabe der Regierung, für ein negatives Szenario gewappnet zu sein. Der Sommer hätte intensiv genutzt werden müssen, um zumindest einen Notfallbetrieb zu garantieren, damit nicht wieder Schüler und Eltern die Leidtragenden sind. Die Regierung steht hier in der Pflicht.
Handlungsempfehlungen
Ausstattung: Alle Schüler müssen über die entsprechenden Geräte verfügen, um digitale Inhalte nutzen zu können. Dies sollte sofort und nicht erst Ende des kommenden Jahres erfolgen. Statt auf „Gratis-Geräte für alle“ zu setzen, sollte nach Bedarf gefördert werden.
Ausbildung: Alle Lehrer müssen über die entsprechenden Kompetenzen im Umgang mit den Endgeräten, Lernprogrammen und pädagogischen Aspekten der Digitalisierung verfügen. Dieses Problem gilt es jetzt im Sommer anzugehen.
Entwicklung der Lernsoftware: Digitale Lernsoftware umfasst weit mehr als nur das Bereitstellen eines PDFs des entsprechenden Lehrbuchs.
Virtuelle Klassenräume: Ein Fernunterricht kann nicht auf den Austausch von Schülern untereinander und mit den Lehrkräften verzichten. Die technischen Möglichkeiten dazu existieren. Von Eltern kann nicht verlangt werden, ohne pädagogische Ausbildung eine Lehrkraft zu ersetzen, mit den Kindern stundenlang die Aufgaben durchzuführen und gleichzeitig produktiv im Home-Office zu arbeiten. Das Bildungsministerium sollte rasch festlegen, welche Software bundesweit zum Einsatz kommt, damit im Falle neuerlicher Schulschließungen zumindest ein digitaler Unterricht im Notbetrieb erfolgen kann.
Mehr interessante Themen
Starthilfe für Österreichs Wirtschaft
Die Regierung hat einen Comeback-Plan angekündigt. Dieser soll die Themen Arbeit, Ökologisierung & Digitalisierung sowie Standortstärkung angehen. Die Details verantworten die jeweiligen Ministerien. Wo es im Motor Österreichs stottert und was konkret zu tun ist, erfahren Sie auf den kommenden Seiten.
Ein Jahr Pandemie
365 Tage im globalen Ausnahmezustand
Wie hat sich Österreich geschlagen? Was ist gut gelaufen, was nicht? Wie geht es jetzt weiter?
Was wir aus dem Corona-Einbruch lernen können
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind nicht überall gleich. Ein Vergleich mit anderen EU-Ländern zeigt: Die Qualität der politischen Führung und der Verwaltung macht einen wichtigen Unterschied.
Bildung in Zeiten der Pandemie
Niederländische Schulen gelten als digitale Vorreiter. Doch selbst dort gab es im Lockdown kaum Lernfortschritte. In Österreich schaut es noch düsterer aus.
DO IT NOW!
LEISTUNG. AUFSTIEG. SICHERHEIT.
Wer heutzutage die Ansicht vertritt, dass Regierungen in konjunkturell guten Zeiten Budgetüberschüsse erwirtschaften sollten, outet sich als wirtschaftspolitischer Reaktionär. Modern ist, wer meint, dass Staaten in Zeiten niedriger Zinsen das für die Umsetzung ihrer politischen Wunschliste erforderliche Geld einfach drucken lassen sollten.