Die Teile sind stärker als das Ganze
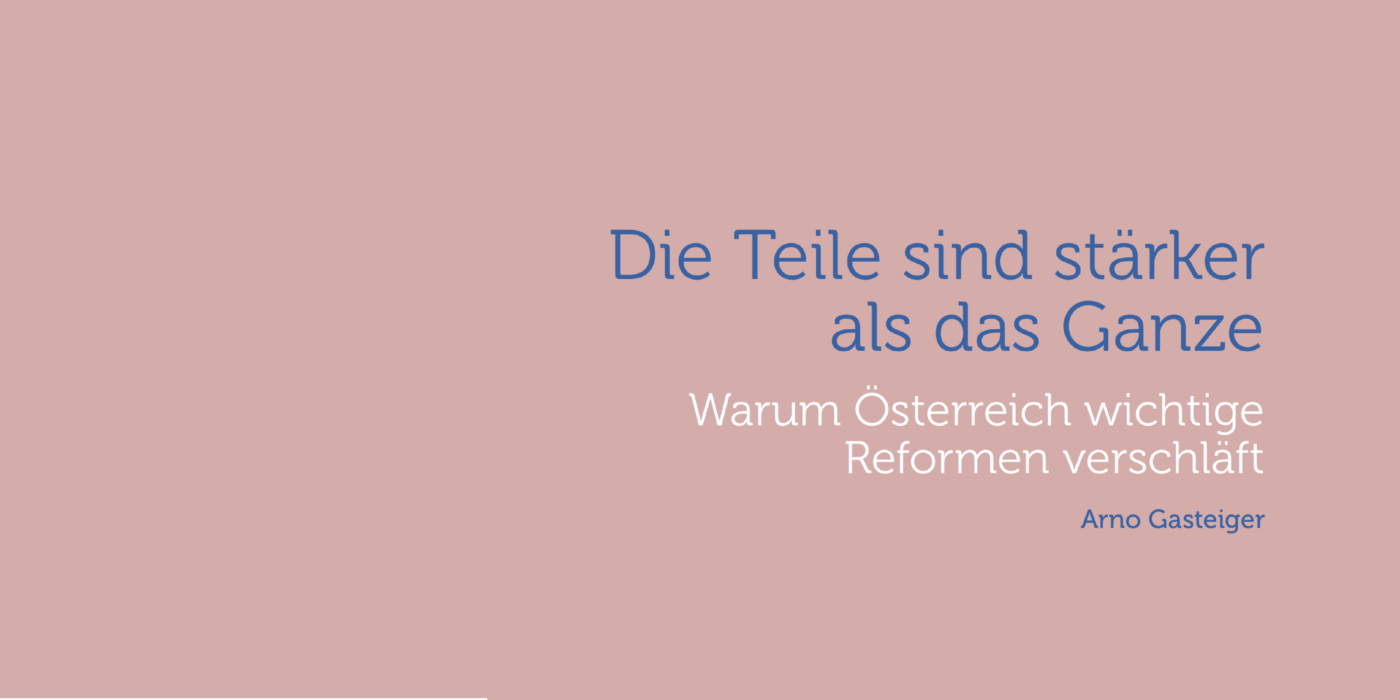
- 28.11.2016
- Lesezeit ca. 2 min
Warum Österreich wichtige Reformen verschläft
Mit Tränen in den Augen musste ein österreichischer Finanzminister in den 1990er-Jahren zur Kenntnis nehmen, dass die Bundesregierung im Nationalrat keine Mehrheit für ein Sparpaket in der Verwaltung finden konnte. Die aus dem Beamtenstand kommenden Abgeordneten beider Regierungsparteien waren fest entschlossen, mit der Opposition gegen das Paket zu stimmen. Die geplante Reform fand nicht statt.
Die längst überfällige Bildungsreform scheitert am Widerstand der Lehrergewerkschaft, die Föderalismusreform am Veto der Landeshauptleute, die Pensionsreform am Nein der Gewerkschaft, die Modernisierung der Gewerbeordnung am Gegenwind aus der Wirtschaftskammer, die Durchforstung der Agrarsubventionen am Protest der bäuerlichen Interessenvertretungen und eine gesamtösterreichische Krankenanstaltenplanung am aktiven Desinteresse der Länder als Rechtsträgerschaft des Großteils der Krankenanstalten. Die notwendige und sinnvolle Zusammenlegung von Bezirksgerichten wurde von der Mehrzahl der Länder bekämpft und durch Jahrzehnte hindurch verhindert. Die Raumordnungskompetenz in der Hand von 2.100 Gemeinden fördert die Zersiedelung und den Landschaftsverbrauch. Für die Finanzierung des Gesundheitswesens sind 19 Krankenkassen, der Bund, die Länder und die Gemeinden zuständig. Die Finanzierung aus einer Hand scheitert daran, dass weder die Kassen noch die Länder bereit sind, Eingriffe in ihre Kompetenzen hinzunehmen.
Österreich ist ein Land mit sehr viel Lebensqualität, ein sicheres Land und ein Land mit hohen sozialen Standards. Wichtige Indikatoren zeigen allerdings, dass Österreich in den vergangenen zehn Jahren im europäischen Vergleich zurückgefallen ist. Das Wirtschaftswachstum ist gering, die Arbeitslosigkeit wächst, das Bildungssystem ist teuer und zu wenig effizient, die Steuerlast zu hoch und die Bürokratie ufert aus. Die Energiepolitik wird von Lobbys gesteuert und Verkehrspolitik findet nicht statt. Eine wichtige Aufgabe der Politik besteht darin, die Rahmenbedingungen an neue Herausforderungen anzupassen, die Ressourcen effizient einzusetzen und künftige Entwicklungen zu gestalten, statt zu erleiden.
Warum geschieht dies in Österreich nicht? Weil die Teile stärker sind als das Ganze!
In der aktuellen Regierungskonstellation müssen wichtigen Entscheidungen zustimmen:
- der Wiener Bürgermeister,
- der Landeshauptmann von Niederösterreich,
- der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB),
- die Arbeiterkammer,
- die Interessenvertretung der Wirtschaft,
- die Interessenvertretung der Landwirtschaft,
- die Beamtengewerkschaft,
- die Lehrergewerkschaft bei Themen, die Schule und Bildung betreffen,
- alle Landeshauptleute, wenn es um Föderalismus geht,
- die Seniorenorganisationen der beiden Regierungsparteien bei allen Themen, die wichtig für ältere Menschen sind.
Da ist der kleinste gemeinsame Nenner meist sehr klein. Dazu kommt die Scheu, vor Wahlen brisante Themen anzugreifen. Das gilt für Nationalrat, Landtage, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer – insgesamt zwölf Wahltermine alle fünf Jahre. Da lässt sich ausrechnen, dass nicht viel Zeit für Reformen bleibt.
Die Landeshauptleute der großen Länder sind deshalb so stark, weil der größere Teil an Abgeordneten zum Nationalrat auf von Landespar- teivorständen erstellten Landeslisten gewählt wird. Wer wiedergewählt werden will, braucht die Zustimmung seines Landeshauptmanns und Lan- desparteiobmanns viel mehr als die seines Bundeskanzlers, Vizekanzlers und Bundesparteiobmanns. So ist die Loyalität zum Teil oft stärker als zum Ganzen. Der Wiener Bürgermeister und der Landeshauptmann von Nie- derösterreich bestimmen nicht allein, aber doch maßgeblich, “wer unter ihnen Bundeskanzler oder Vizekanzler wird”. Nachhaltige Schädigungen ihrer Spitzenmandatare nehmen sie dabei in Kauf.
Verstärkt wird die Dominanz der Teile durch die Stärke der Interessenvertretungen. Der überwiegende Teil der Mandatare der SPÖ kommt aus dem ÖGB und der Arbeiterkammer, derjenige der ÖVP aus dem Bereich der Interessenvertretungen von Wirtschaft und Landwirtschaft sowie der Beamten. Erfolge bei Wahlen in die Kammern werden als wichtig betrachtet und binden sehr viel Kraft. Hin und wieder entsteht der Eindruck, dass sie für die jeweiligen Spitzenkandidaten wichtiger sind als ein gutes Abschneiden bei bundesweiten Wahlen. Wenn der Wiener Bürgermeister, der Landeshauptmann von Niederösterreich und die Präsidenten großer Interessenvertretungen die österreichische Politik mehr bestimmen als Bundesregierung und Parlament, entsteht ein Legitimationsproblem. Sie alle stehen nur für einen Teil der Staatsbürger zur Wahl, nicht für die gesamte österreichische Bevölkerung.
Respekt verdient die Entscheidung der SP über CETA, die offensichtlich gegen den Widerstand von ÖGB und AK erfolgte. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob es sich dabei um einen Einzelfall handelt oder um den Beginn des Zurückdrängens der Dominanz der Teile.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





