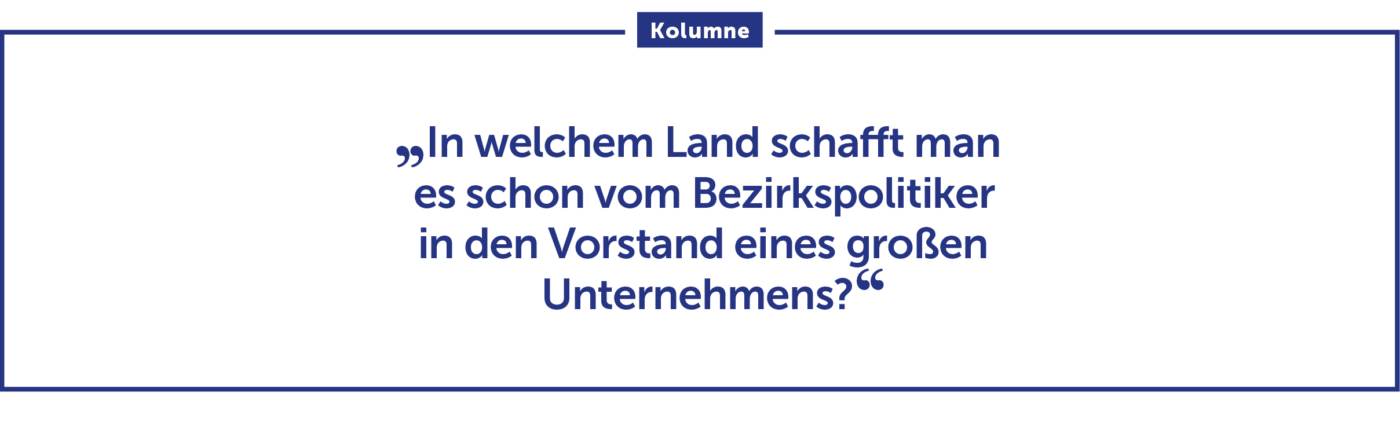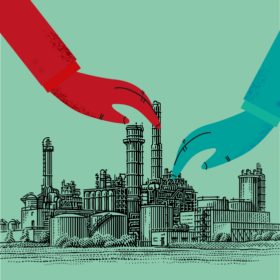Das fatale Comeback der Staatswirtschaft
- 02.12.2019
- Lesezeit ca. 4 min
Vor 20 Jahren hat die ÖVP Staatsbetriebe reihenweise privatisiert. Ausgerechnet unter bürgerlicher Führung plant die Staatswirtschaft nun ihr großes Comeback.
Von Bruno Kreiskys politischem Wirken ist mehr geblieben als dieser eine Satz, auch wenn sich viele nur an diesen erinnern werden: „Mir bereiten ein paar Milliarden (Schilling Anm.) Schulden weniger schlaflose Nächte als mir ein paar Hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten würden.“ Das hatte schon was. Auch wenn Zeithistoriker wissen wollen, dass die Österreicher nach vielen sorgenfreien Nächten unglücklicherweise mit beidem aufgewacht sind: mit überbordenden Staatsschulden und Hunderttausenden zusätzlichen Arbeitslosen.
Warum das Abenteuer in die große weite Welt der Wirtschaft für den Staat in einem Desaster der Sonderklasse endete, ist vergleichsweise schnell erklärt: Die Regierungen der damaligen Zeit konnten der Versuchung nicht widerstehen, die Führung milliardenschwerer Unternehmen politisch verlässlichen Parteikollegen statt Fachleuten anzuvertrauen.
Das ist übrigens kein Makel der Ära Kreisky, sondern ein systemimmanentes Phänomen. In keinen Unternehmen spielt die politische Zugehörigkeit von Mitarbeitern eine derart tragende Rolle wie in jenen mit staatlicher Beteiligung. In keinen Unternehmen ist die Dichte an Führungspersonen mit politischer Vergangenheit so hoch wie in jenen mit staatlicher Beteiligung. Und in keinen Unternehmen ist die wirtschaftliche Performance so schlecht wie in jenen mit staatlicher Beteiligung.
Nun machen auch Eigentümer privater Firmen Fehler, aber keiner von ihnen käme auf die Idee, die Führung des eigenen Betriebs Freunden anzuvertrauen, die zwar dasselbe Weltbild teilen, aber nicht die nötige Qualifikation mitbringen. Das heißt natürlich nicht, dass eine Führungskraft kein Parteibuch haben darf. Es gibt auch fähige Manager, die aus der Politik kommen. Sie sind nur eine verdammt selten anzutreffende Spezies.
Wie die Causa Casinos Austria zeigt, ist die heimische Politik nicht lernfähig. Oder haben Sie jemals von einem anderen westeuropäischen Land gehört, in dem ein Bezirkspolitiker den Sprung in den Vorstand eines großen Unternehmens geschafft hätte? Nein? Kein Wunder, so etwas gibt es nur noch in Österreich. Was viele andere vergleichbare Länder von Österreich unterscheidet, ist, dass in diesen das Aktienrecht ernst genommen wird.
Außerhalb der Staatsgrenzen wurde längst verstanden, dass die Anteile an Unternehmen nicht regierenden Parteien gehören, sondern den Bürgern. In anderen mit Österreich vergleichbaren Ländern ist klar, dass der staatliche Einfluss auf öffentliche Betriebe nicht mit der Bestellung von Vorständen und Abteilungsleitern einhergeht, sondern bei der Ernennung der Aufsichtsräte endet. So wie das auch das österreichische Aktienrecht vorsieht – nur dass das hierzulande noch niemandem bewusst zu sein scheint.
Nun gibt es für das Problem politischer Einflussnahme in die Vorstandsbestellung von Staatsbetrieben erfreulicherweise eine einfache wie sichere Lösung: die komplette Privatisierung betroffener Unternehmen. Davon will aber niemand etwas wissen. Vielmehr wurde am Donnerstag vergangener Woche mit den Stimmen von SPÖ und NEOS ein Untersuchungsausschuss zu den Casinos beantragt. Fein. Früher hätten Liberale vermutlich neben einem U-Ausschuss auch die komplette Privatisierung der Casinos beantragt, wobei sie von der ÖVP unterstützt worden wären. Zumal ja niemand wirklich der Meinung sein wird, dass das Zocken an heimischen Spieltischen zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört. Vom Herausgeber des „Falter“ einmal abgesehen.
Paradoxerweise bereitet das bürgerliche Lager unter Führung der ÖVP eine große Offensive des Staates in der heimischen Wirtschaft vor. So war unlängst in der Nachrichtenagentur Bloomberg zu lesen, dass die Verstaatlichtenholding ÖBAG (die frühere ÖIAG) nun ernst mit der angekündigten Ausweitung ihres Portfolios mache. Es wurde ein fünfköpfiges Investment-Komitee etabliert, das für den Staat Investitionsziele ausfindig machen soll. Im Fokus stünden Technologie- und Produktionsbetriebe. Mit anderen Worten: so gut wie alle heimischen Leitbetriebe.
In Summe fänden sich laut Bloomberg bereits rund 100 Unternehmen auf der Liste, die teilweise verstaatlicht werden sollen. Allesamt Unternehmen, die aus Sicht der ÖBAG „wichtig für das Land“ seien. Der Staat soll die jeweiligen Firmen nicht nur auf ihrem Wachstumspfad begleiten, sondern auch vor feindlichen Übernahmen schützen. Allen voran vor dem Zugriff ausländischer Kapitalgeber.
Ob die betroffenen Unternehmen den Einstieg des Staates als „freundlich“ auffassen würden? Schwer zu sagen. Sie wissen nämlich nicht, ob sie zu jenen auserwählten Leitbetrieben gehören, die dringend unter staatlichen Schutz zu stellen sind. Das weiß nämlich nur die Spitze der ÖBAG.
Vielleicht sollten deren Vertreter die betroffenen Unternehmen ja einmal fragen, was sie von der Idee halten. So ganz grundsätzlich. Bruno Kreisky hätte sie jedenfalls gefallen, daran besteht nicht der geringste Zweifel.
Kolumne von Franz Schellhorn im aktuellen Profil (01.12.2019).
Mehr interessante Themen
Budgetdisziplin auf ÖVP-Art: In fünf Jahren 90 Milliarden neue Schulden
Bis 2027 will die Regierung jedes Jahr mehr Geld ausgeben als zu Zeiten der Corona-Krise. Wie das mit einer bürgerlichen Finanzpolitik zusammengeht? Gar nicht.
Ist der neue SPÖ-Chef ein Segen für die ÖVP?
Andreas Babler war der Wunschkandidat des bürgerlichen Lagers für die SPÖ-Spitze. Dabei rät schon ein altes Sprichwort, dass man sich vor seinen Wünschen hüten solle.
Der grüne Schwanz wedelt mit dem türkisen Hund
Die Regierungsklausur zeigte, wer in dieser Koalition das Sagen hat: Es sind die Grünen, die der dreimal größeren ÖVP ihre Wünsche aufzwingen.
Bruno Kreisky hätte seine Freude an der ÖVP
Das 5-Punkte-Programm der SPÖ zur Inflationsbekämpfung hat alles, was das Sozialistenherz höher schlagen lässt. Viel Platz hat die ÖVP der SPÖ aber nicht übrig gelassen.
Die ÖVP auf Chefsuche: Wie wär’s mit einem Sozialdemokraten?
Die deutsche Regierung schwört die Bevölkerung auf harte Zeiten ein. Niemand geringerer als ein früherer SPD-Chef empfiehlt, wieder länger zu arbeiten.
Hände weg von der OMV!
Eine Verstaatlichung würde Milliarden kosten und die Preise langfristig erhöhen.