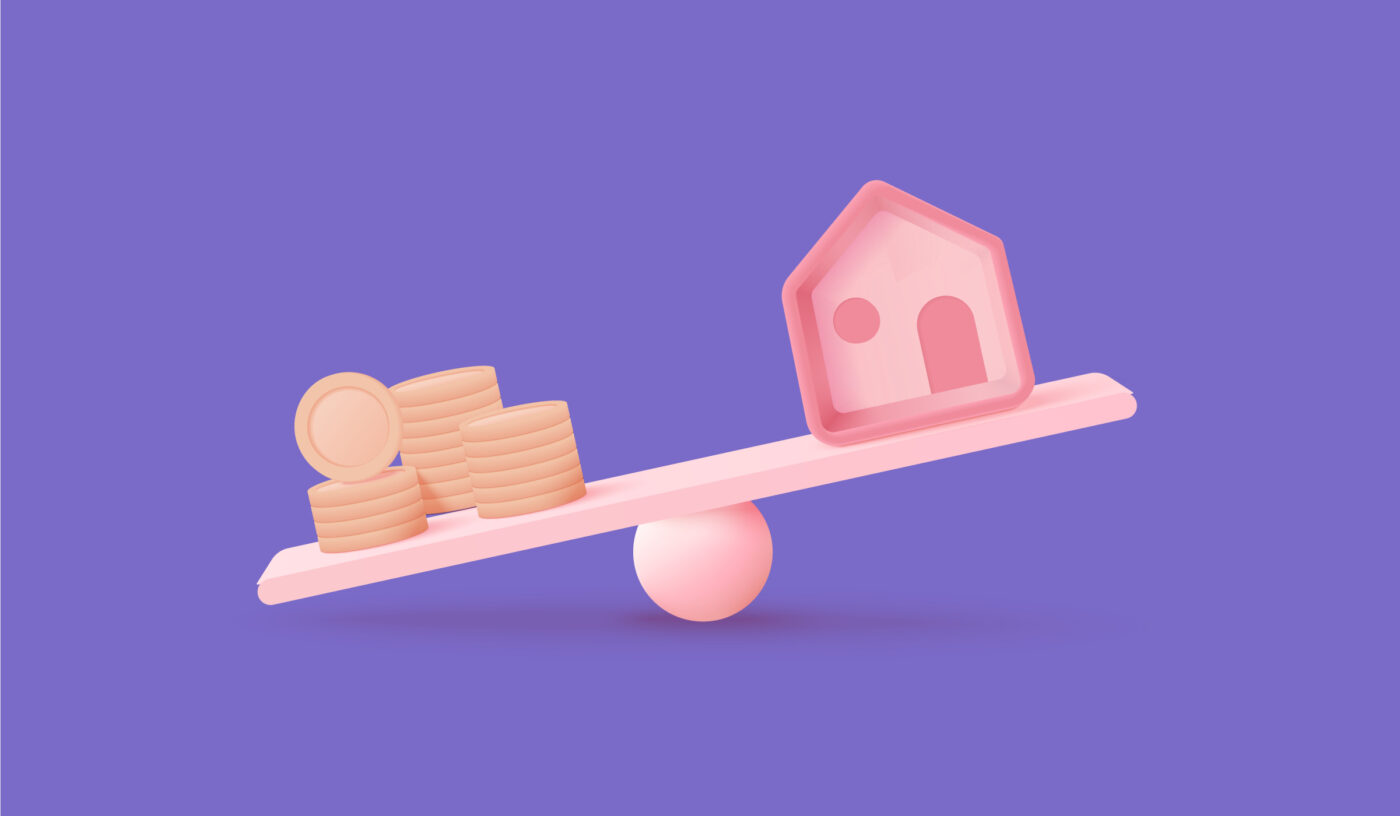Rauf mit den Löhnen! Runter mit den Mieten?
- 30.01.2023
- Lesezeit ca. 3 min
Die Anpassung der Mieten an die Inflation steht an. Nicht mehr und nicht weniger.
Wertsicherungsklauseln sind eine sinnvolle Sache: Mit ihnen stellen Vermieter sicher, dass ihre Mieteinnahmen im Laufe der Zeit nicht an Kaufkraft verlieren. Auch für die Mieter sind sie hilfreich, weil ihre Mieten dadurch nicht schneller steigen als ihre Einkommen, die ja ebenfalls regelmäßig und nachträglich an die Inflation angepasst werden.
Durch die starke Teuerung und die aufgeschobenen Valorisierungen aus dem Jahr 2021 haben die Mieten nun mächtig angezogen. Und weil die Inflationsanpassung auch für regulierte Mieten vorgesehen ist – dort sogar per Gesetz – waren auch sie davor nicht sicher. Auch nicht die Wiener Gemeindewohnungen, weil sich eben auch die Stadt als Eigentümerin nicht ganz der Wertsicherungslogik entziehen kann.
Schon jonglieren die üblichen Verführer mit den Zahlen und suggerieren, dass vor allem die Kategoriemieten unverhältnismäßig stark steigen würden. Nun kann man es in der Tat nicht in Ordnung finden, dass sie mehrfach pro Jahr und noch vor den jeweiligen Lohnrunden erhöht werden dürfen. Aber grundsätzlich übersehen solche Berechnungen wohl nicht ganz zufällig, dass gerade die Kategoriemieten seit Anfang 2018 ganze vier Jahre lang konstant waren und selbst durch die dreimalige Anpassung im letzten Jahr den aufgestauten Rückstand auf den Verbraucherpreisindex (VPI) immer noch nicht ganz aufgeholt haben. Für die Mieter war das jahrelang ein ausgezeichneter Deal. Aber irgendwann muss man eben auf den gesetzlich vorgesehenen Pfad zurückkommen.
Dennoch kursieren nun viele alternative Vorschläge. Wifo-Chef Felbermayr brachte am Wochenende die Version ins Spiel, die Mieten nicht an den VPI zu koppeln, sondern an die Entwicklung der Baukosten. Er räumte aber selbst ein, dass die Baukosten in der Regel stärker steigen als der VPI. Über die Jahre würden die Mieter also erheblich mehr zahlen. Auch der Vorschlag, die Mieten an die Lohnentwicklung zu koppeln, hält sich wacker. Die Vermieter hätten wohl auch hier nichts dagegen, da die Löhne in halbwegs normalen Zeiten stärker steigen als die Inflation. Die nächsten Tarifrunden werden sicher lustig, wenn die Gewerkschaften „Rauf mit den Löhnen! Rauf mit den Mieten!“ plakatieren. Die SPÖ hält sich nur noch verzweifelt die Augen zu und will die Mieten bis 2025 gleich ganz einfrieren.
So sieht keine seriöse Wohnungsmarktpolitik aus. Natürlich können die Mieter nicht eine Erhöhung nach der nächsten aus dem Ärmel schütteln. Aber denkt eigentlich auch jemand an jene, die keine der geschützten Wohnungen ergattern konnten und auch nicht zufällig über einen Mietvertrag aus dem letzten Jahrhundert verfügen? Kann es eine gute Idee sein, wenn ein Teil der Gesellschaft immer höhere Marktmieten berappt, während sich die öffentliche Diskussion vor allem um die Privilegien der Alteingesessenen dreht?
Nötig ist eine Wohnungsmarktpolitik, die auch die Angebotsseite in den Blick nimmt, die bedenkt, wie viel in den kommenden Jahrzehnten in den Bestand investiert werden muss und sich von der jahrelang praktizierten Klientelpolitik endlich verabschiedet.
Gastkommentar von Jan Kluge für die “Kurier” (28.01.2023).
Mehr interessante Themen
Ein Jahr Dreierkoalition: Wählerverluste trotz Schonprogramm
“Es war immer die These: Jede Regierung die reformiert, verliert. Und jetzt verliert die Regierung ohne Reform.”
Mietpreisbremse: Wer soll in Zukunft noch bauen?
Eine Frage muss sich die Bundesregierung stellen: Wer soll in Zukunft bauen, wenn der Anreiz für den privaten Wohnbau durch die #Mietpreisbremse genommen wird?
Baubewilligungen in Österreich auf Talfahrt
Die Zahl der Baubewilligungen für neue Wohnungen in Österreich ist seit der Zinswende 2023 massiv zurückgegangen. Wo zuvor regelmäßig mehr als 15.000 Wohnungen pro Quartal genehmigt wurden, sind es zuletzt oft unter 10.000. Der Rückgang ist damit der stärkste seit über einem Jahrzehnt.
Wie Österreich seit 1917 seinen Wohnungsmarkt systematisch ruiniert.
(Über) 100 Jahre Interventionsspirale im österreichischen Wohnungsmarkt
Die Mietpreisbremse für den freien Markt wird kommen. Und mit ihr eine ganze Reihe an unbeabsichtigten Nebenwirkungen. In Österreich haben wir über 100 Jahre Erfahrung mit Mietpreiseingriffen. Nur gelernt haben wir nichts daraus.
Wie viel verdienen Kammer-Beschäftigte?
Nach heftiger Kritik an der 4,2-Prozent-Gehaltserhöhung für Kammermitarbeiter ruderte die Kammerführung zurück: Die Erhöhung bleibt, aber sie kommt um sechs Monate später.
Die Legende vom teuren Wohnen
Während die Stadt Wien ihre Gebühren und Abgaben erhöht, sich eine Sonderdividende ihres Energieanbieters gönnt und die staatlichen Netzbetreiber satte Preisaufschläge verlangen, macht die Politik den privaten Sektor für die hohe Inflation verantwortlich.