Ist das österreichische Pensionssystem fit für diese Herausforderungen?
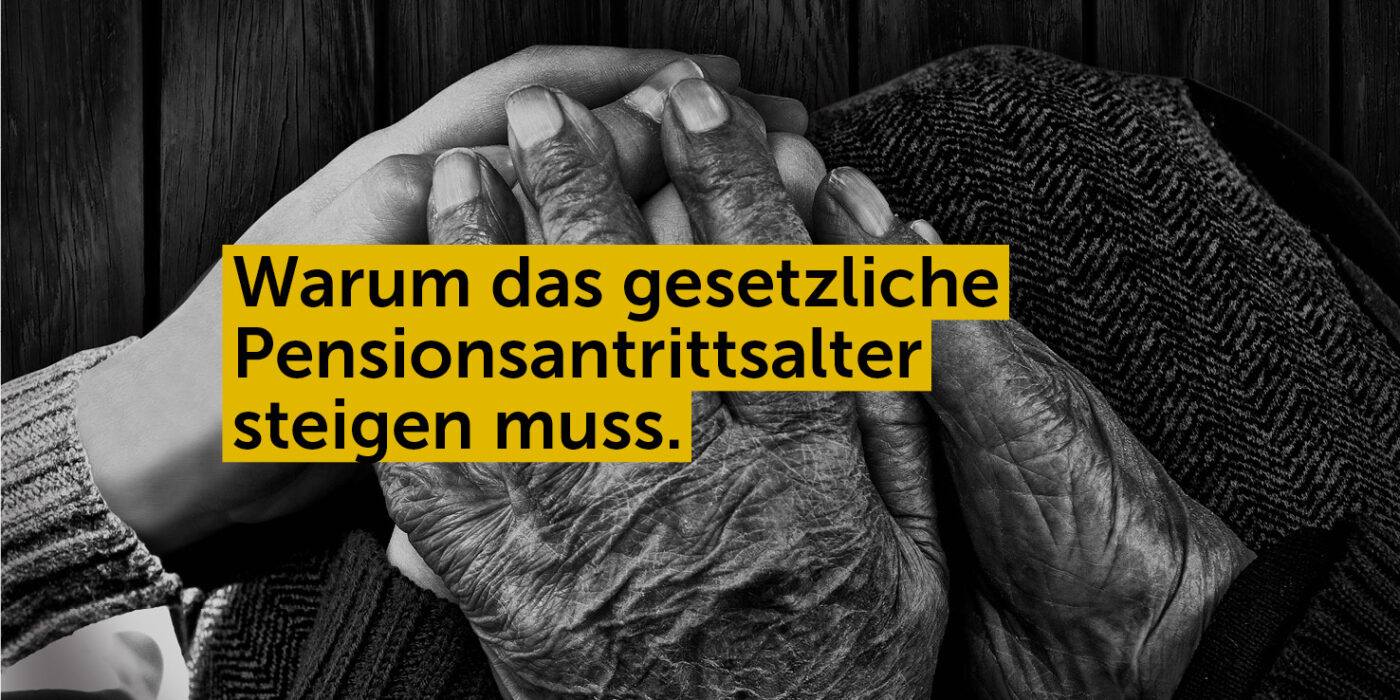
- 02.04.2019
- Lesezeit ca. 3 min
Viele Stimmen, von der EU-Kommission über die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bis hin zum Internationalen Währungsfonds (IWF), warnen österreichische Finanzminister immer wieder vor den bereits hohen und noch weiter steigenden Kosten durch die Alterung der Bevölkerung. Die Regierung sieht hier allerdings keinen Handlungsbedarf, man verweist gerne darauf, dass das faktische Antrittsalter in den letzten Jahren ohnehin leicht gestiegen sei.
Christl und Kucsera (2016) zeigen aber, dass dies nicht ausreicht, da die aktuellen Ab- und Zuschläge im österreichischen Pensionssystem recht nahe an dem optimalen Wert liegen.[1] Das bedeutet, dass ein früherer oder späterer Antritt des Ruhestands das Pensionssystem weder be- noch entlastet.
Ein späterer Abschied vom Arbeitsleben hat kurzfristig durchaus positive Effekte für die Finanzierung des Pensionssystems: Menschen, die länger arbeiten, zahlen während dieser Zeit weiter Pensionsversicherungsbeiträge ein und erhalten noch keine Pension. Vergessen wird aber oft der belastende Teil des späteren Antritts: Durch das längere Arbeitsleben werden auch höhere Pensionsansprüche erworben, die entsprechend auch ausbezahlt werden und damit die Gesamtausgaben zukünftig ansteigen lassen. Ein späterer tatsächlicher Pensionsantritt reduziert damit das Defizit im Pensionssystem nicht nachhaltig, sondern verschiebt die Problematik in die Zukunft.
Wenn der spätere Pensionsbeginn nicht hilft, was bleibt dann als Lösung? Damit das Pensionssystem auch langfristig ohne Pensionskürzungen finanzierbar bleibt, muss das gesetzliche Pensionsalter steigen. Das bedeutet, dass die Menschen zukünftig länger im Erwerbsleben bleiben müssen, um die gleiche monatliche Pension zu erhalten. Das ist aus persönlicher Sicht zwar ärgerlich, aber notwendig, um das System zu stabilisieren. Konkret sollte sich das gesetzliche Pensionsantrittsalter an der steigenden Lebenserwartung orientieren. Wenn länger ausgezahlt wird, sollte auch länger eingezahlt werden.
Passiert das nicht, wird die Gesamtsumme der bezogenen Pension mit der Lebenserwartung immer weiter ansteigen. Um das auszugleichen, muss das gesetzliche Pensionsantrittsalter aber nicht eins zu eins mit der Lebenserwartung steigen. Es muss nur das Verhältnis zwischen der Zeit in Erwerbstätigkeit und der Zeit in Pension gleich bleiben. Aktuell beträgt das Verhältnis der Zeit in Erwerbstätigkeit zu der in Pension etwa zwei zu eins. Das bedeutet: Steigt die Lebenserwartung um drei Monate, ist es notwendig, dass die Menschen um zwei Monate länger arbeiten. Gleichzeitig verlängert sich die Zeit in Pension um einen Monat. Wenn die Politik ausschließlich am faktischen AntrittsalterDas gesetzliche Antrittsalter von Frauen wird in Österreich bis 2033 stufenweise auf 65 Jahre angehoben und damit an jenes der Männer angeglichen. Das tatsächliche Antrittsalter liegt aktuell für Männer bei circa 62, für Frauen bei 61 Jahren. More schrauben möchte, dann wird sie nichts an der grundlegenden Schieflage der Pensionssystems ändern. Kurzfristig ist der gesetzlichen Vorsorge zwar mit mehr Einnahmen geholfen (weil die Menschen länger einzahlen), langfristig steigen aber die Ausgaben – weil die Pensionisten höhere Ansprüche haben.
Tatsächlich wurden zuletzt 1992 erste Schritte für ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter gesetzt. Doch die Angleichung des Antrittsalters für Frauen an jenes der Männer (aktuell: 60 vs. 65 Jahre) beginnt erst ab 2024 und ist nach derzeitigen Bestimmungen erst im Jahr 2033 abgeschlossen. Österreich hat aktuell gemeinsam mit Polen das niedrigste Pensionsantrittsalter innerhalb der EU.[2] Eine Anpassung sollte daher früher passieren. Beamtinnen müssen bereits jetzt bis zum Alter von 65 Jahren arbeiten, um ihren Ruhegenuss beziehen zu können. Das AntrittsalterDas gesetzliche Antrittsalter von Frauen wird in Österreich bis 2033 stufenweise auf 65 Jahre angehoben und damit an jenes der Männer angeglichen. Das tatsächliche Antrittsalter liegt aktuell für Männer bei circa 62, für Frauen bei 61 Jahren. More von 60 Jahren führt dazu, dass Frauen niedrigere Pensionen erhalten, weil sie gerade in den spätern Erwerbsjahren, in denen man oft mehr verdient als zuvor, nicht mehr für ihre Pension einzahlen bzw. ansparen können.
Die österreichische Politik schreckt traditionell davor zurück, das Pensionsantrittsalter anzuheben. Denn eine solche Maßnahme würde so wirken, als würde man der älteren Generation „etwas wegnehmen“. Tatsächlich ist es aber so, dass der Generationenvertrag heute bereits zulasten der jungen Menschen geht und eine Reform ein Gebot der Fairness wäre.
Denn wegen der steigenden Lebenserwartung müssen die Kinder der Babyboomer relativ viel einzahlen und werden im Vergleich zu ihren Eltern geringere Pensionen erhalten. Hammer et al. (2018) zeigen eindrücklich, dass der Generationenvertrag in vielen Ländern zukünftig nicht mehr erfüllt werden kann, weil zu wenig in die Ausbildung der Kinder – der zukünftigen Beitragszahler – investiert wurde und wird, um die generösen Pensionen für die ältere Generation aufrechtzuerhalten. Das ist deshalb so, weil eine zahlenmäßig immer kleinere Gruppe – die Babyboomer haben weniger Kinder – im Umlagesystem die Pensionen ihrer Eltern finanzieren. Zwar gibt es interfamiliäre Transfers: Die Eltern haben gute Einkommen und Pensionen und vererben Erspartes an die Kinder. Dies kann aber nicht als Ausgleich zu einem gerechten und nachhaltigen Pensionssystem gesehen werden.
Das Ziel eines geringeren Defizits im Pensionssystem ist unter anderem deswegen wichtig, weil es Österreichs finanziellen Spielraum für Zukunftsinvestitionen, wie jene in Bildung oder Innovationen, vergrößern würde. Damit eine Pensionsreform erfolgreich ist, muss sie nicht nur die finanzielle Nachhaltigkeit im Blick haben, sondern auch die Lastenverteilung zwischen den Beitragszahlern und den Empfängern der unterschiedlichen Pensionsleistungen. Das Beispiel Schweden zeigt, wie es gehen könnte.
Fußnoten
- Als optimal wird ein Zu- oder Abschlag bezeichnet, wenn dieser finanzmathematisch neutral ist, d. h., dass sich der Barwert der Pension nicht verändert, wenn man früher oder später in den Ruhestand geht. Für die Finanzierung des Pensionssystems wäre es also langfristig betrachtet irrelevant, ob das effektive Antrittsalter unter dem gesetzlichen läge. ↩
- Ab drei Kindern ist in Tschechien ein noch früherer Pensionsbezug möglich. ↩
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





