Schlussfolgerungen
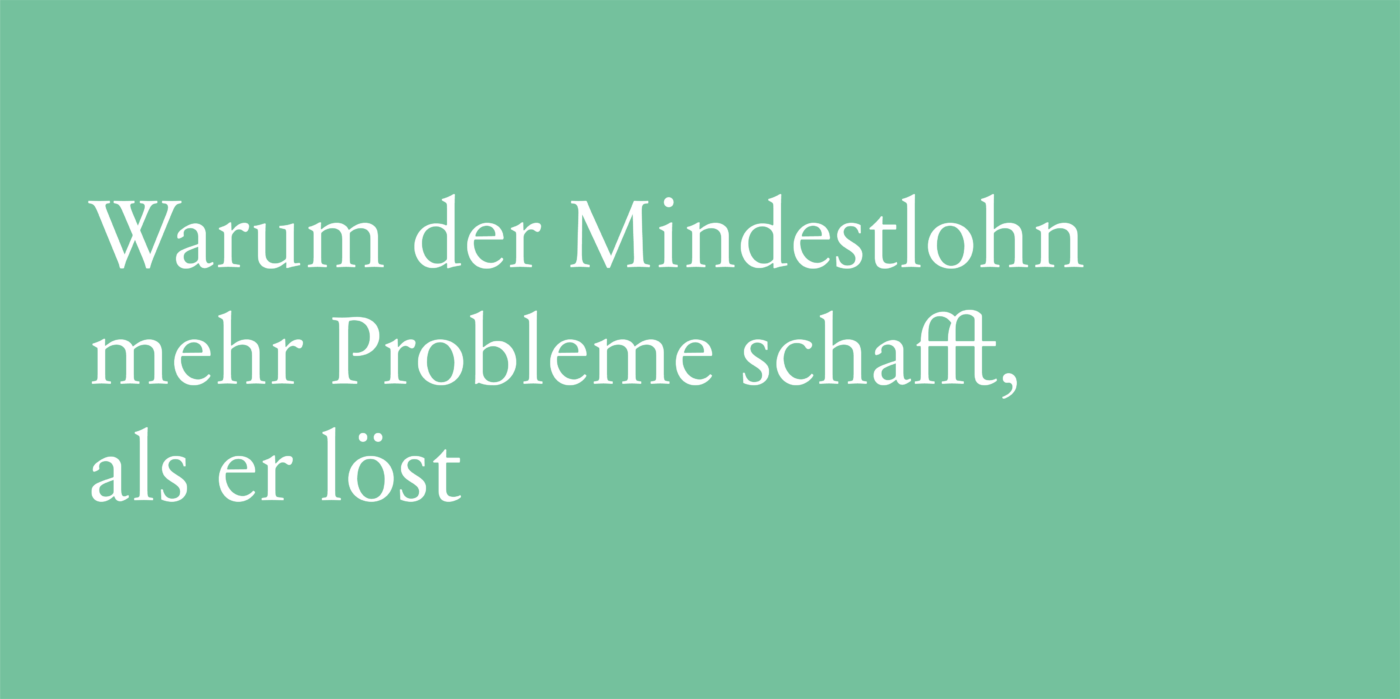
- 16.02.2017
- Lesezeit ca. 1 min
Dieser Beschäftigungseffekt kommt in der politischen Diskussion kaum vor, obwohl er bedeutend ist. Denn gehen Jobs verloren, trifft dies genau jene Gruppen, die es am Arbeitsmarkt ohnehin sehr schwer haben: Jüngere, niedrig qualifizierte Arbeitnehmer. Ihre Jobs sind als erstes weg. Ein zu hoher Mindestlohn ist für das politische Ziel, die Armut zu verringern, also kontraproduktiv. Unser Policy Brief zeigt, dass etwa 150.000 von 2,168 Millionen ganzjährig in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmern weniger als den angepeilten Mindestlohn von 1.500 Euro brutto verdienen. Das liegt daran, dass bereits viele Kollektivverträge Löhne von über 1.500 Euro brutto vorsehen. Sektoren, wo Löhne noch unter dieser Grenze liegen, sind die Herstellung von Waren, die Gastronomie, der Handel, die Landwirtschaft sowie der Bereich Gesundheit und Sozialwesen.
Wir haben eine zurückhaltende Schätzung vorgenommen, wie sich ein Mindestlohn auf die Beschäftigung auswirken würde. Sie bezieht sich nur auf sieben von einer Vielzahl an nicht öffentlichen Branchen, da die jeweilige Produktivität bekannt sein muss. Darüber hinaus bezieht diese Schätzung auch Stellen in teils staatlich geführten Branchen wie Gesundheit und Soziales nicht mit ein. Allein so zeigt sich, dass bis zu 20.000 Jobs in Gefahr sind, je nachdem, wie sich der Mindestlohn auf andere kollektivvertragliche Lohnstufen (für etwas Höherqualifizierte bzw. Ältere) auswirkt. Nicht zuletzt deshalb spricht sich die Agenda Austria gegen einen einheitlichen Mindestlohn aus.
Ein weiterer Grund gegen einen gesetzlichen Mindestlohn ist, dass dieser zu starr ist. Er erlaubt es nicht, die Löhne an eine eventuell flaue Konjunktur oder eine Krise in einer bestimmten Branche anzupassen. Kollektivverträge sind besser geeignet, da die Verluste an Jobs für gering qualifizierte bzw. junge Arbeitskräfte geringer sind. Auch ermöglichen es Kollektivvertragsverhandlungen, besser auf regionale Unterschiede[1] und konjunkturelle Begebenheiten zu reagieren. Trotzdem: Auch wenn die Kollektivvertragslöhne erhöht werden, zeigt sich ein empirisch nachweisbarer Verlust an Jobs. Gleichzeitig wäre in Österreich in manchen Branchen, z.B. der Gastronomie, ein höherer Kollektivvertragslohn möglich, ohne dass Jobs verloren gingen, (siehe Christl, Köppl-Turyna & Kucsera, 2016). Allerdings ist dort dann mit Preissteigerungen zu rechnen.
Nun zum Mindestlohn als Instrument der Armutsbekämpfung. Es wäre eine Illusion, zu glauben, dass ein Mindestlohn sich ausschließlich positiv auf das Einkommen jener auswirkt, die dann einen höheren Lohn beziehen würden. Erstens zeigt sich, dass progressive und damit höhere Steuern sowie bedarfsorientierte Transferleistungen, die dann wegfallen, das Einkommen wieder schmälern[2]. Zweitens gingen eben Arbeitsplätze verloren, was die Armut erhöhen würde.
Ein Mindestlohn ist auch ein wenig treffsicheres Mittel gegen Armut. Warum? Armut wird laut EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Condition) nicht am Einkommen eines Einzelnen gemessen, sondern am Einkommen, das auf jede Person in einem Haushalt entfällt (Haushalts-Äquivalenzeinkommen). Ein Mindestlohn beeinflusst möglicherweise das Einkommen einer der Personen im Haushalt. Und das ist oft die Person, die im Mehr-Personen-Haushalt den niedrigeren Lohn erhält. Daher zeigt sich in Deutschland, dass die Mindestlohnverdiener auch nicht öfter Gefahr laufen, arm zu sein als andere[3]. Hauptgrund für Armutsgefährdung ist es, keinen Job zu haben.
In Österreich sind EU-SILC 2015 zufolge knapp 14 Prozent der Österreicher armutsgefährdet. In der Gruppe der Erwerbstätigen sind knapp 8 Prozent armutsgefährdet (”working poor”), die Gefahr ist also geringer. Einen, wenn auch niedrig entlohnten, Job zu haben, senkt das Risiko von Armut deutlich. Dieses Risiko besteht vor allem für Ein-Personen-Haushalte, Alleinerzieher und Haushalte mit mehr als zwei Kindern. Der Mindestlohn und die damit verbundenen Effekte verschaffen hier kaum Abhilfe. Lautet das politische Ziel, armutsgefährdete Haushalte besser zu unterstützen, wären niedrigere Sozialabgaben oder höhere Transferleistungen für diese Gruppen eine viel effizientere Lösung. Nicht zuletzt würde, wie ausgeführt, ein Mindestlohn eben Jobs kosten und die Arbeitslosigkeit – die Hauptursache für Armut – erhöhen.
Fußnoten
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





