Einleitung
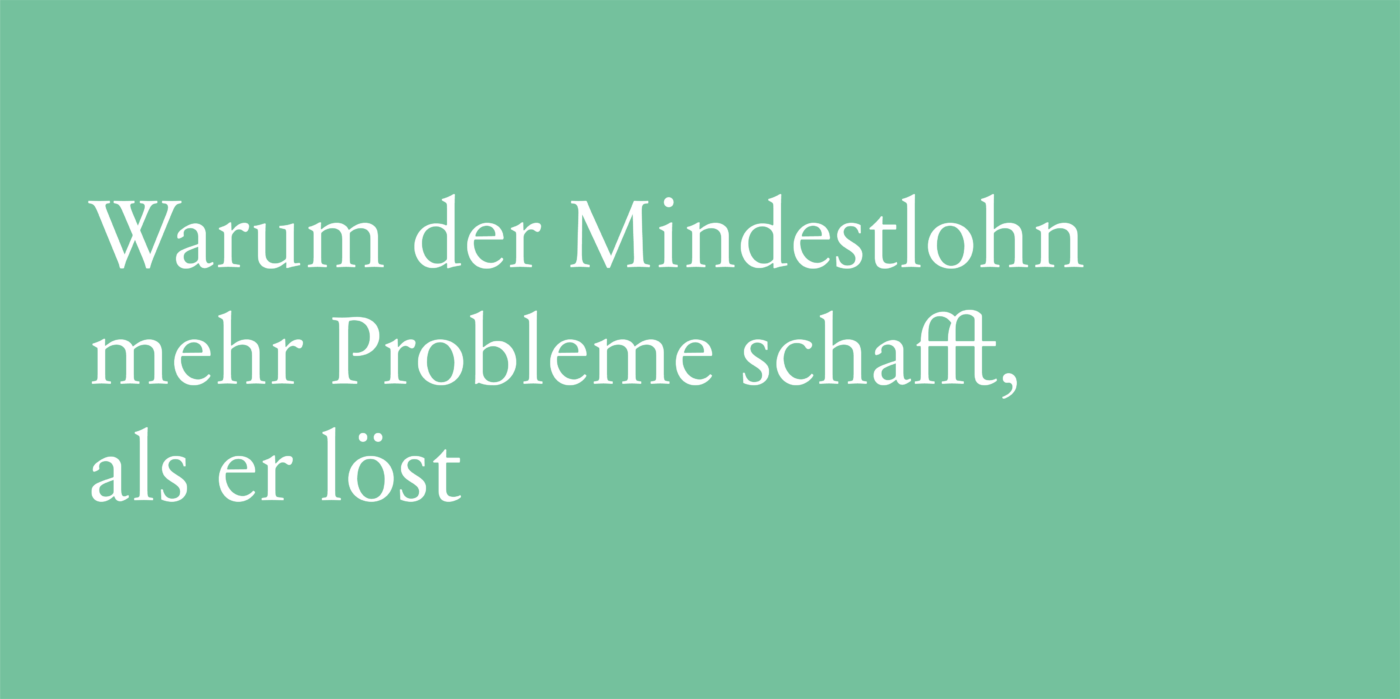
- 16.02.2017
- Lesezeit ca. 1 min
Wer in Vollzeit arbeitet, soll mindestens 1.500 Euro brutto verdienen. Bis Ende Juni haben die Sozialpartner Zeit, einen Vorschlag auszuarbeiten, wie ein solcher flächendeckender Mindestlohn in den Kollektivverträgen für alle Branchen eingeführt werden kann. Wenn es die Kammern und der ÖGB nicht schaffen, will die Regierung selbst tätig werden und per Gesetz einen Mindestlohn einführen. So sieht es das kürzlich beschlossene Arbeitsprogramm der Regierung 2017/2018 vor. Damit greift die Regierung auch eine langjährige Forderung der Gewerkschaft nach einer höheren Untergrenze in den Kollektivverträgen auf.
Die offensichtliche Konsequenz eines Lohns von mindestens 1.500 Euro brutto ist, dass dann manche Arbeitnehmer mehr verdienen werden als jetzt. Kurzfristig jedenfalls. Ob das auch langfristig der Fall ist, steht auf einem anderen Blatt. Der Mindestlohn soll, so argumentieren die Befürworter, gegen Armut helfen. Dabei übersehen sie aber, dass dann auch das Gesetz der Nachfrage zum Tragen kommt, und dieses spielt eine zentrale Rolle. Steigt der Preis eines Gutes (jener der Arbeitskraft), so nimmt die Nachfrage danach ab. Ein Mindestlohn erhöht also nicht nur manche Einkommen, sondern er wirkt sich auch auf die Zahl der Jobs aus, und zwar möglicherweise negativ.
Selbst die Befürworter eines Mindestlohns zweifeln selten an, dass die Hauptursache für Armut nicht ein zu niedriger Lohn ist, sondern Arbeitslosigkeit. Ob ein Mindestlohn die Armut senkt, ist also alles andere als klar. Jene, die wegen des Mindestlohns den Job verlieren, rutschen möglicherweise in die Armut ab.
In einigen europäischen Ländern gilt bereits ein gesetzlicher Mindestlohn. Anderswo gibt es, wie auch in Österreich, Kollektivverträge, die es ermöglichen, die Löhne an das Alter, die Beschäftigungsdauer, die Branche, die Qualifikation des Arbeitnehmers oder an die jeweilige Region zu koppeln. Erfassen die Kollektivverträge einen hohen Prozentsatz der Arbeitnehmer, was hierzulande ja der Fall ist, entsprechen sie de facto ebenfalls einem Mindestlohn – er ist nur nicht einheitlich, sondern für verschiedene Branchen unterschiedlich hoch. Das System der Kollektivverträge hat den Vorteil, dass es flexibler ist als ein gesetzlich vorgeschriebener Mindestlohn – es ist leichter, die Löhne z.B. an eine flaue Konjunktur oder die Krise in einer bestimmten Branche anzupassen.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





