Schlussfolgerungen
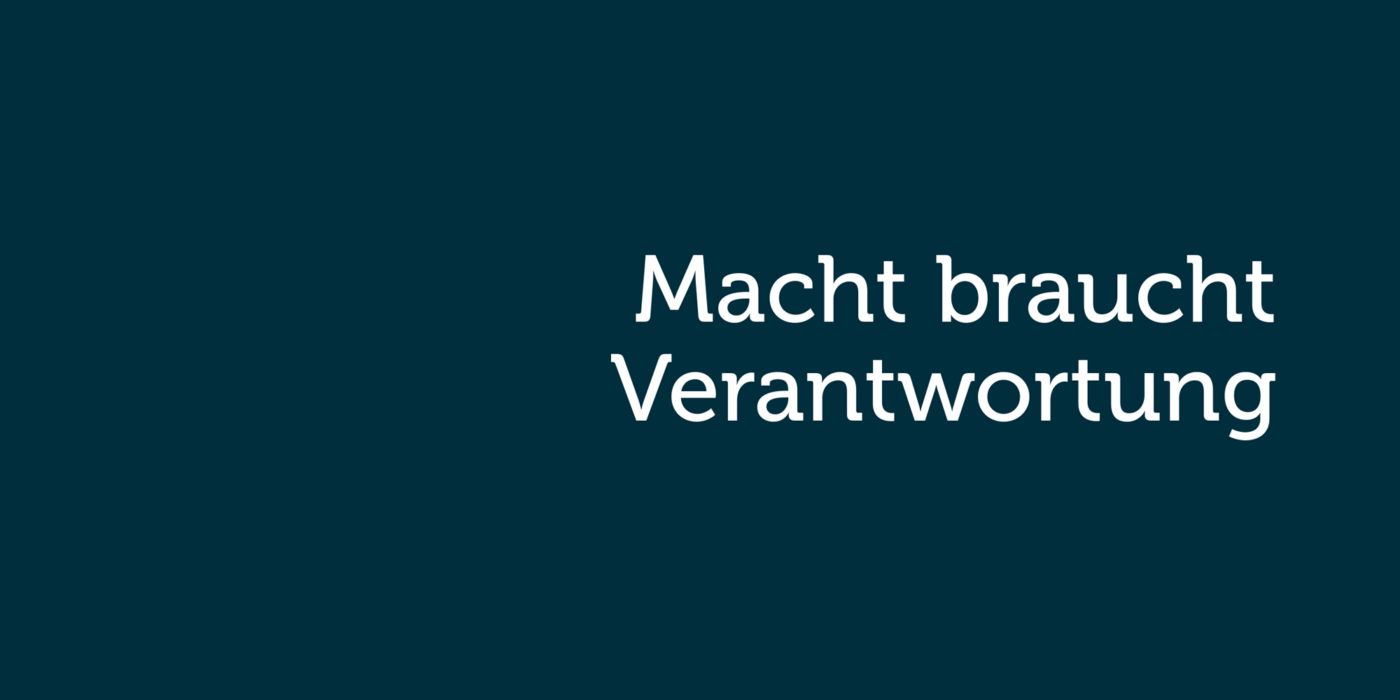
- 08.10.2015
- Lesezeit ca. 3 min
Warum die Länder ihre Ausgaben über eigene Steuern finanzieren sollten
In einem Vorbericht haben wir argumentiert, wie lokale Finanzautonomie und fiskalischer Wettbewerb dazu beitragen könnten, die Politik besser auf lokale Bedürfnisse zuzuschneiden. In der vorliegenden vertiefenden Studie haben wir nun gezeigt, wie eine Steuerautonomie der Länder mit einem Zuschlagssystem konkret funktionieren könnte.
Eine weiterhin einheitliche Ermittlung der Bemessungsgrundlagen verhindert eine Verkomplizierung der Steuerverwaltung. Im ersten Schritt senkt der Bund seine Steuersätze auf ein Niveau, das gerade ausreicht, um seinen Teil des Steueraufkommens zu erzielen. Dann erheben die Länder einen einheitlichen Zuschlag, um ihren Teil des Steueraufkommens zu erzielen, anstatt dass ihnen wie bisher die Steuereinnahmen über den Verteilschlüssel zugewiesen werden. Beides zusammen addiert sich exakt zu den bisherigen Steuersätzen auf. Der Bund und die Gesamtheit der Länder erhalten gleich hohe Steuereinnahmen und die Steuerpflichtigen zahlen gleich viel Steuern wie jetzt auch. Es zeigt sich aber, dass zwar alle Länder gemeinsam mit einem einheitlichen Zuschlag ein gleich hohes Steueraufkommen erzielen, nicht jedoch jedes Land für sich genommen. Wirtschaftlich starke Länder, bei denen sich die Steuerbasis überdurchschnittlich stark konzentriert, würden gewinnen und mit einem einheitlichen Zuschlag mehr Aufkommen erzielen, als sie jetzt mit dem Verteilschlüssel an gemeinsamen Bundesabgaben erhalten. Wirtschaftliche schwache Länder würden verlieren. Das zeigt, dass der Verteilschlüssel eine versteckte Umverteilung zwischen den Ländern enthält, die jedoch schwer nachvollziehbar ist. Wenn man die Gewinne und Verluste als explizite Nettozahlungen eines Finanzausgleichs abbildet, könnten die Gewinner die Verlierer exakt kompensieren und die heutige Situation wäre vollständig wiederhergestellt. Der Vorteil wäre jedoch, dass die Umverteilung zwischen den Regionen Österreichs nicht versteckt und unbedacht, sondern offen und transparent erfolgt und somit die Politik anhand nachvollziehbarer Kriterien einen bewussten Entschluss für einen solidarischen Ausgleich fassen kann.
Die Steuerautonomie der Länder kann also mit einem einfachen Zuschlagssystem leicht eingeführt werden. Nun kann der fiskalische Wettbewerb einsetzen, denn jedes Land kann jetzt unabhängig von den anderen einen höheren oder niedrigeren Zuschlag wählen. Die Auswirkungen des Steuerwettbewerbs sind wie erwartet eine Steuersenkung, welche in kleinen Bundesländern stärker ausfällt. Berücksichtigt man die Interaktionen mit dem Ausland, so können die resultierenden Steuersenkungen Einkommen und Wachstum fördern und zu einer Verbesserung für alle Bundesländer führen, da der Standort Österreich als Gesamtes attraktiver wird. Auf diesem Weg könnten Finanzautonomie und fiskalischer Wettbewerb die Einkommen in Österreich auf ein dauerhaft um 1,7 Prozent höheres Niveau heben; in manchen Bundesländern mehr und in anderen weniger.[2] Ebenfalls haben wir gezeigt, dass ein solidarischer Finanzausgleich möglich ist, ohne die entstehenden Vorteile der fiskalischen Autonomie zu konterkarieren. In Summe deuten unsere Simulationen auf eine stärkere regionale Konvergenz durch mehr fiskalische Autonomie und daraus resultierenden Wettbewerb hin.
Der fiskalische Wettbewerb mit lokaler Finanzautonomie wird nicht alle Probleme in Österreich lösen. Auch in der Schweiz, die seit vielen Jahren lokale Autonomie und Steuerwettbewerb erfolgreich praktiziert, sind die Folgen des Steuerwettbewerbs und des Finanzausgleichs nicht über jede Kritik erhaben. Angesichts der bestehenden Fehlanreize im österreichischen Föderalismus könnte jedoch eine grundlegende Reform große Wohlfahrtsgewinne ermöglichen. Es ist höchste Zeit, in verschiedenen Szenarien die möglichen Folgen der lokalen Finanzautonomie und des Steuerwettbewerbs konkret auszuloten und die Vor- und Nachteile breit zu diskutieren.
Fußnoten
- Vgl. Keuschnigg und Loretz (2015). ↩
- Es sei betont, dass die quantitativen Ergebnisse auf vielen Annahmen beruhen und mit Vorsicht zu interpretieren sind. Die Reaktionen der Länderpolitik und die Anpassungen der Besteuerten sind komplexer, als sie mit einem Modell je erfasst werden könnten. Zwar bildet das Modell mit seinen Parametern die Stärke der wirtschaftlichen Anpassungsvorgänge so ab, dass sie den Ergebnissen der empirischen Forschung entsprechen. Diese liefert aber auch nur eine Bandbreite von Schätzungen und keine eindeutigen Ergebnisse. Daher ist es immer möglich, mit anderer Parametrisierung größere oder kleinere Auswirkungen zu ermitteln. Es wäre aber wenig hilfreich, über die Einführung einer Finanzautonomie zu diskutieren, ohne wenigstens eine grobe Vorstellung über mögliche quantitative Auswirkungen zu haben. Die Ergebnisse können auch im Lichte der Erfahrungen anderer Staaten eingeschätzt werden. ↩
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





