Macht braucht Verantwortung
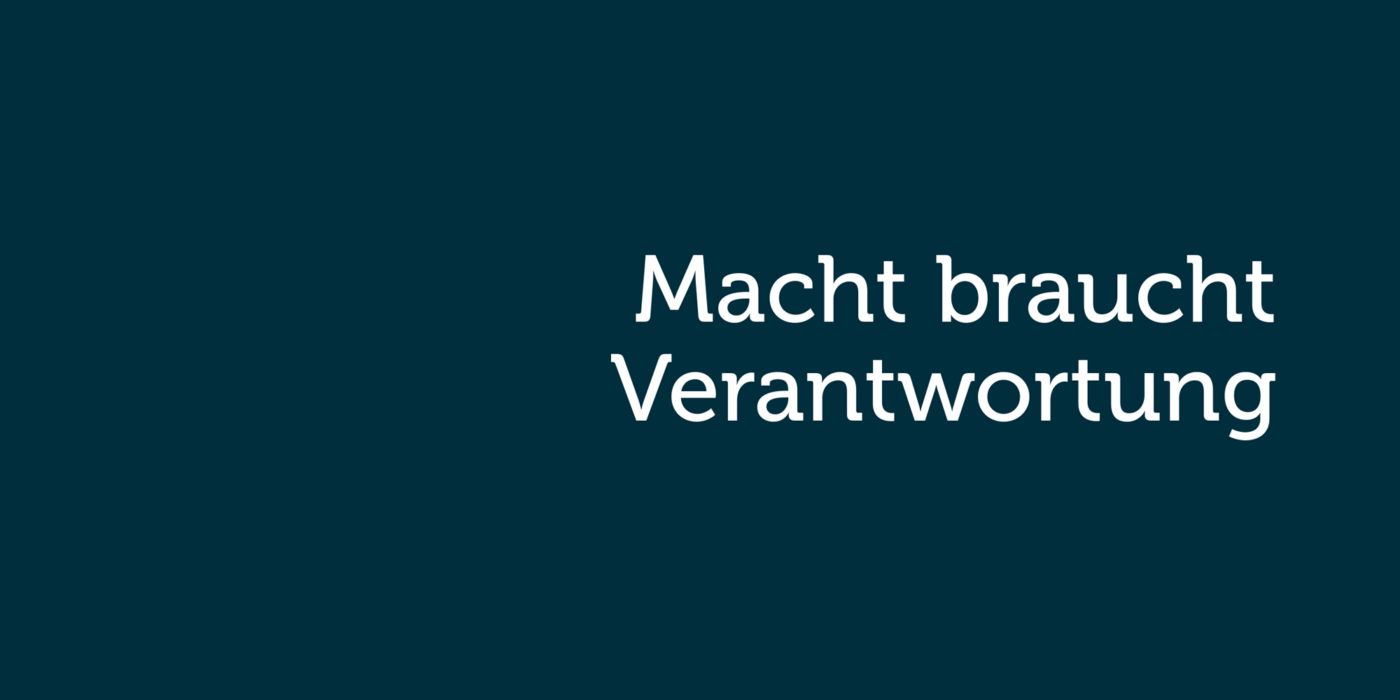
- 08.10.2015
- Lesezeit ca. 3 min
Warum die Länder ihre Ausgaben über eigene Steuern finanzieren sollten
In Österreich können Länder und Gemeinden derzeit kaum Steuern autonom festlegen – sie bekommen für die Erledigung ihrer Aufgaben Steuereinnahmen des Bundes gemäß einem fixen Verteilschlüssel zugewiesen, dem Finanzausgleich. Das wirkt sich ähnlich aus wie Preisabsprachen bei Unternehmen: Die Leistungen, die der Bürger bzw. Kunde erhält, sind teurer als nötig. Unsere Studie zeigt, warum die Länder ihre Ausgaben über eigene Steuern finanzieren sollten: Ein Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern erhöht die Einkommen, führt zu niedrigeren Steuersätzen und verringert den Abstand zwischen reichen und armen Ländern.
Vorwort: Warum diese Studie?
Österreichs Ländern mehr Macht zu geben, ist hierzulande ungefähr so populär wie der Vorschlag, einem Bankräuber die Schlüssel für den Haupttresor in die Hand zu drücken. Es ist nämlich so, dass der Föderalismus vielerorts für das zentrale Problem des Landes gehalten wird; für eine Art innerstaatliche Wucherung, der niemand mehr Herr zu werden scheint. Schon gar nicht die Bundesregierung, deren Bedeutung sich in den Augen zahlreicher Landesvertreter in einer zentralen Geldsammelstelle erschöpft.
Genau da liegt das Problem: Mit dem Bund treibt nur einer jenes Geld ein, das großzügig von unzähligen Händen übers Land verteilt wird. Die Republik leidet also nicht an zu vielen kleinen Gemeinden, zu vielen Bezirken oder zu vielen Ländern. Sondern an der nahezu völligen Entkoppelung von Einnahmenverantwortung und Ausgabenverantwortung. Allein der „Fall Kärnten“ liefert den unmissverständlichen Hinweis, dass diese Form der getrennten Verantwortungen zu schweren finanziellen Verwerfungen führt.
Was wäre also zu tun? Klar ist, dass sich Österreich kein zweites Kärnten leisten kann. Die Bürger könnten den föderalen Einheiten Verantwortung nehmen und einen straff organisierten Zentralstaat nach skandinavischem Vorbild wählen. Der Bund würde nicht nur Steuern einheben, sondern auch entscheiden, was damit zu geschehen hat. Die Alternative wäre, den Ländern mehr Verantwortung zu übertragen – und zwar in dem Sinn, dass sie einen höheren Anteil ihrer Ausgaben selbst eintreiben müssen.
Beide Varianten wären ein deutlicher Fortschritt gegenüber der aktuellen österreichischen Staatsorganisation, die letzten Endes eine Einladung zur großherzigen Geldverschwendung ist. Aus Sicht der Agenda Austria ist eine De-facto-Entmachtung der Länder politisch nicht durchsetzbar. Keine Regierungspartei hätte die Kraft, einen derartig radikalen Umbau des Staates in ihren eigenen Reihen durchzusetzen. Weshalb wir für einen Schweizer Wettbewerbsföderalismus light plädieren und in dieser Arbeit Antworten auf folgende Fragen suchen: Wie wäre eine partielle Steuerautonomie für Österreichs Länder zu organisieren? Welche Bundesländer würden zu Beginn profitieren und wie könnten die anfangs schlechter gestellten den Steuerwettbewerb zu ihren Gunsten nutzen? Und schließlich: Wie hätte ein solidarischer Finanzausgleich auszusehen, um benachteiligten Regionen auf die Beine zu helfen?
Unsere Gastautoren Christian Keuschnigg (Universität St. Gallen) und Simon Loretz (IHS) haben bemerkenswerte Antworten gefunden. Die durchgeführten Simulationsrechnungen zeigen, dass eine fortschreitende Steuerautonomie in Österreich nicht nur möglich, sondern auch zum Vorteil aller umsetzbar wäre. Aber sehen Sie selbst.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen
Franz Schellhorn
Direktor Agenda Austria
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





