Wie kann man dem Dezemberfieber vorbeugen?
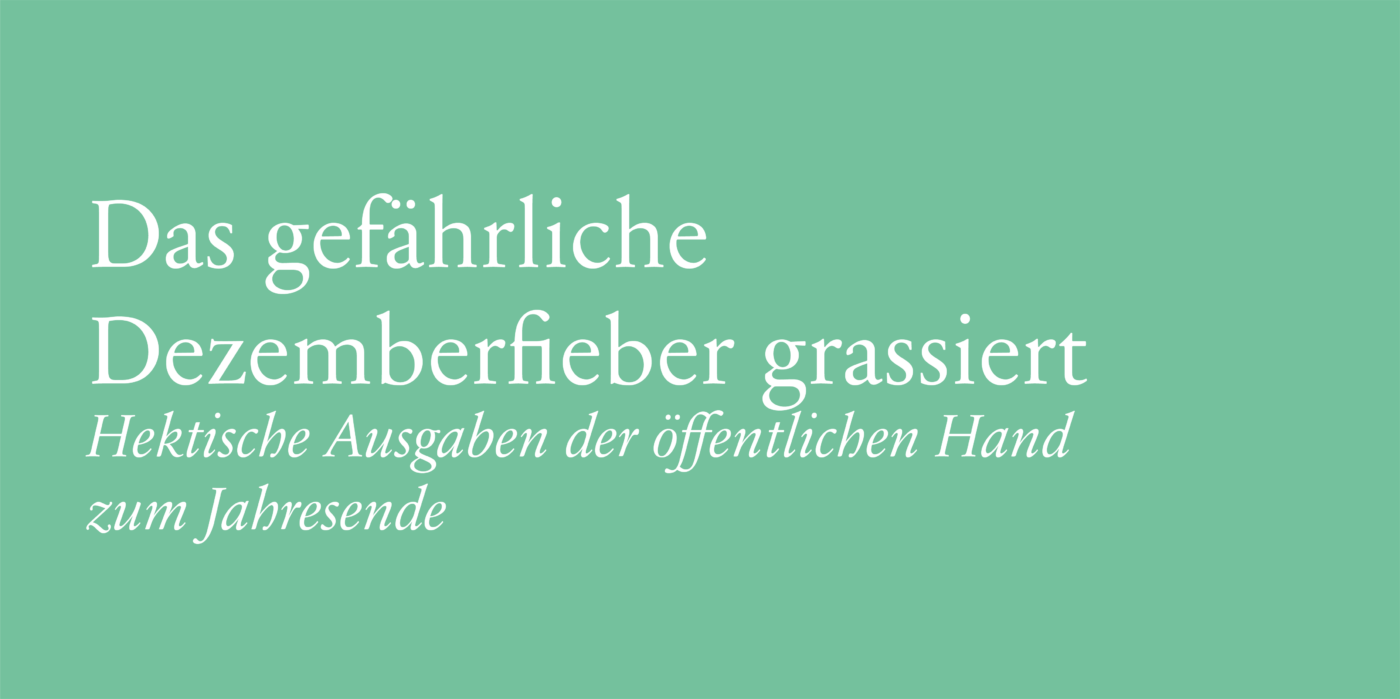
- 14.12.2017
- Lesezeit ca. 1 min
Hektische Ausgaben der öffentlichen Hand zum Jahresende
Das sogenannte „Carry-over“, also die Möglichkeit, für nicht ausgeschöpfte Budgetrahmen Rücklagen in den einzelnen Ministerien zu bilden, wird oft als geeignetes Mittel gegen das Dezemberfieber gesehen. Den Ministerien wird erlaubt, nicht ausgegebenes Geld in die nächste Budgetperiode mitzunehmen, um einen ineffizienten Umgang mit Steuergeldern zu vermeiden.
Die Auffassung, dass nicht ausgeschöpfte Budgetrahmen eine verlorene Möglichkeit sind, Geld auszugeben, ist weit verbreitet. Wird die Bildung von Rücklagen nicht erlaubt, ist das aus Sicht des Budgetverantwortlichen auch zutreffend. Zudem würde ein hoher ungenutzter Teil des Budgets signalisieren, dass zuviel Geld zur Verfügung stand. Dem Finanzministerium würde also signalisiert, dass es bei der nächsten Budgetverhandlung restriktiver vorgehen sollte. Dem könnte die Bildung von Rücklagen entgegenwirken. So wäre es vernünftig, Rücklagen bilden zu können, um eine im Dezember teure Investition auf Jänner oder Februar des nächsten Jahres zu verschieben, sofern sich günstigere Preise abzeichnen.
Die sechs Voraussetzungen für eine sinnvolle Rücklagenbildung
Zu lösen ist folgendes Dilemma: Erstens ist zu verhindern, dass Budgetverantwortliche gegen Ende des Jahres mit beiden Händen Geld aus den öffentlichen Fenstern werfen, um den Budgetrahmen voll auszuschöpfen. Zweitens ist sicherzustellen, dass sparsame Ressorts für den effizienten Umgang mit öffentlichen Geldern belohnt werden, also einen Anreiz haben, den Budgetrahmen nicht voll auszuschöpfen.
Dazu braucht es die Möglichkeiten, Rücklagen zu bilden. Allerdings nur unter folgenden Voraussetzungen:
- Knappe Budgetierung: Entscheidend ist, dass die ursprüngliche Budgetierung in den einzelnen Teilbereichen bereits knapp für die entsprechenden Aufgaben gewählt wurde. Der Finanzminister muss sicher sein, dass nicht verwendetes Geld aus Effizienzgewinnen stammt und nicht aus einer Überbudgetierung. Das bedeutet: Es dürfen nur dann Rücklagen gebildet werden, wenn sie Ergebnis von tatsächlichen Einsparungen sind, etwa im Bereich der Personalkosten. Wenn es eine Überbudgetierung gibt, dann sollte man keine allzu großen Rücklagen erlauben. Hohe Ausgaben im letzten Monat sind generell ein Anzeichen für eine Überbudgetierung.
- Ein gutes Bilanzierungssystem und Berichtswesen: Eine schnelle und transparente Budgetierung ist notwendig, um den Budgetverantwortlichen möglichst unkompliziert alle notwendigen Informationen über bestehende Rücklagen zu geben. Eine Voraussetzung, die in Österreich mittlerweile weitgehend erfüllt ist.
- Finanzierungsmöglichkeit: Die Rücklagen müssen finanzierbar sein. Zweifel über die Finanzierung der Rücklagen machen das System instabil.
- Kontrollmechanismen: Die Verwendung der Rücklagen muss genau kontrolliert werden. Ansonsten werden unnötige Ausgaben zum Ende des Jahres nur zu unnötigen Ausgaben im nächsten Jahr.
- Dezentralisierung der Budgethoheit: Ein gewisser Grad an Dezentralisierung der Budgetverantwortlichkeit muss gegeben sein. Weil es dem Finanzministerium nicht möglich ist, jede Kostenstelle aller Ministerien vorzugeben. Zudem können Einsparungspotenziale auf unterster Ebene leichter erkannt werden. Die Budgetverantwortlichen sollten auch selbst entscheiden können, welche Ausgaben sie kürzen würden. Voraussetzung dafür ist allerdings eine knappe Budgetierung, die den sorgsamen Umgang mit Steuergeld garantiert.
- Langfristige Fiskalpolitik: Sollte die Regierung gezielt auf eine kurzfristige Fiskalpolitik setzen, so wird die Rücklagenbildung nicht die gewünschten Effekte erzielen, weil die Budgetverantwortlichen dann damit rechnen müssen, dass ihnen das Budget im Falle von Rücklagen gekürzt wird.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





