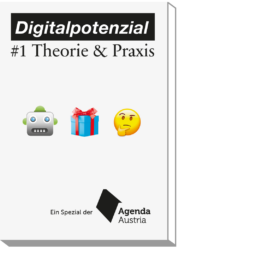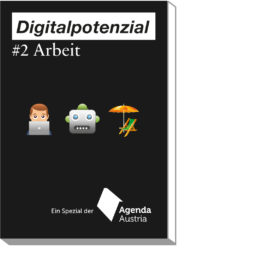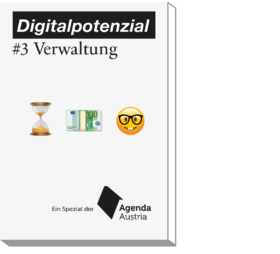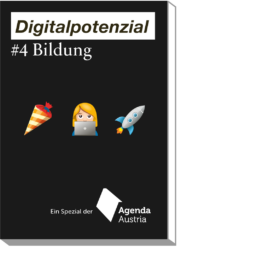Digitalpotenzial #1: Theorie & Praxis
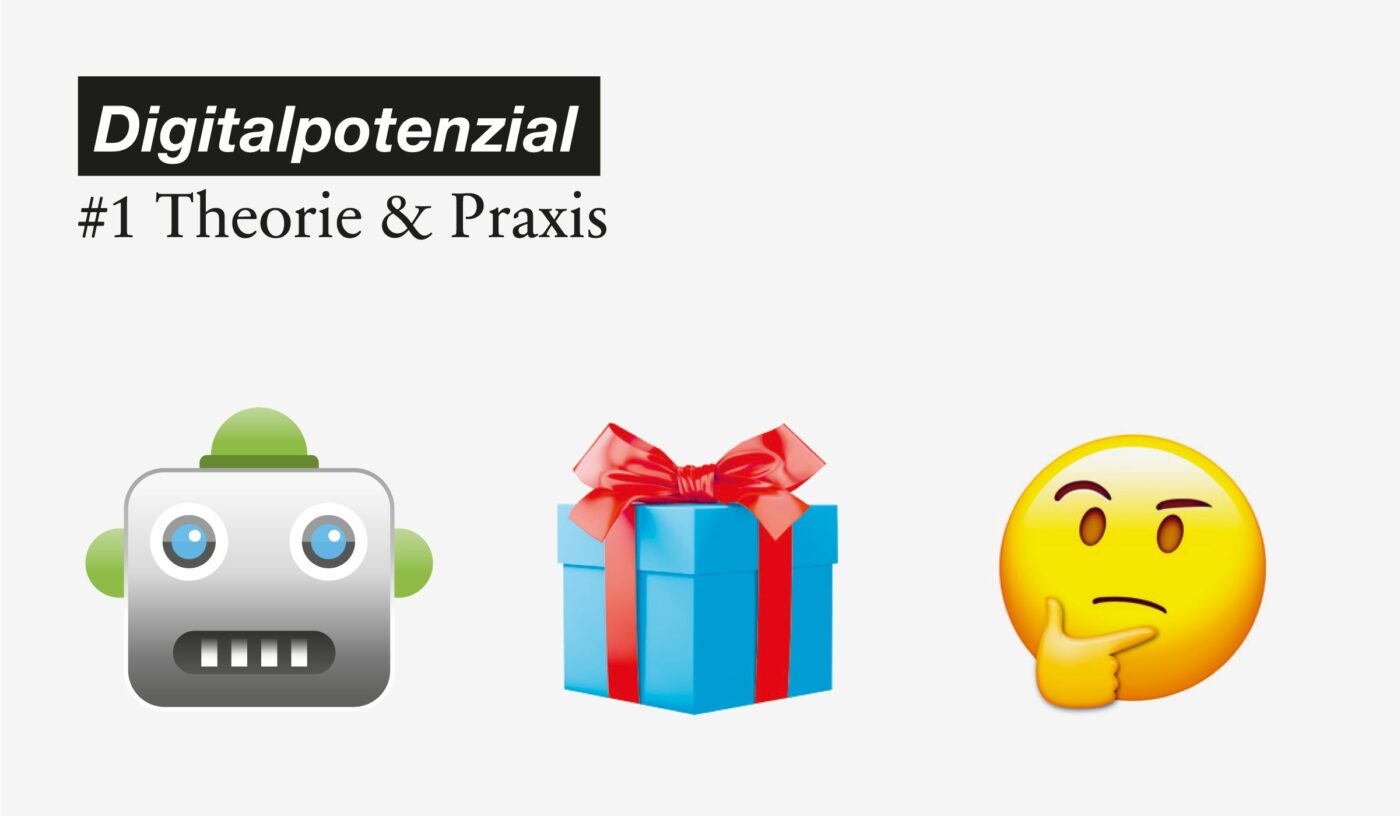
- 01.01.2019
- Lesezeit ca. 5 min
Chancen und Risiken des digitalen Zeitalters
Handlungsempfehlungen
Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Es gilt daher die Chancen neuer Technologien zu nutzen und mögliche Gefahren zu minimieren. In diesem Sinne sind die folgenden Handlungsvorschläge nur ein Ausschnitt aus einem Entwurf für die umfassende Gestaltung einer digitalen Gesellschaft.
Verfügbarkeit öffentlicher Daten garantieren
Daten sind der Treibstoff des digitalen Fortschritts. Daten über staatliche Ausgaben, aber auch Informationen, die über Sensoren (Verkehrsaufkommen, Luftqualität etc.) von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden, sollten jedem Bürger in technisch zugänglicher Form aufbereitet auf Online-Portalen zur Verfügung stehen. Die Offenlegung von Behördendaten, die von Computern lesbar sind, erhöht die öffentliche Teilhabe. Nicht davon betroffen sind personifizierte Daten.
Auch Innovation und Wirtschaft werden durch die Offenlegung von Daten gefördert. Das zeigt etwa das Beispiel von anonymisierten Mikrodaten in Dänemark. Dort legen Unternehmen, die öffentliche Förderungen bekommen haben, firmeninterne Daten in anonymisierter Form offen. So kann auch wissenschaftlich überprüft werden, ob die staatlichen Fördermittel fruchtbringend eingesetzt worden sind.
Digitale Fähigkeiten lebenslang schulen
Je früher digitale Fähigkeiten erlernt werden, desto besser. In Digitalwerkstätten können Kinder bereits im Alter von sechs bis 14 Jahren spielerisch den Umgang mit Programmiersprachen erlernen.[1] Besonders in dieser frühen Bildungsphase kann Gamification – das Erlernen von Inhalten über spielerische Anwendungen – einen wichtigen Beitrag leisten. Finnland, das 2016 ein neues digitales Curriculum (Schulstufe 1–9) eingeführt hat, nutzt bereits jetzt spielerische Anleitungen zum Erlernen von Programmiersprachen in den ersten Bildungsjahren.[2] Ebenso werden junge Menschen über „teaching coding through storytelling“ spielerisch mit vermeintlich trockenen Programmiersprachen vertraut gemacht.[3]
In späteren Bildungsphasen sollten „Open-Book-Tests“ erprobt werden, also bei Prüfungen auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden.
Anerkennung von Online-Bildung erweitern
In Kombination mit der schulischen Förderung nehmen internetbasierte Bildungsformen eine wichtige Rolle ein. Durch ein standardisiertes Verfahren sollte die Anerkennung von Online-Kursen wie MOOCs im Bildungsbereich, aber auch auf dem Arbeitsmarkt (Aus- und Fortbildungszertifikate) ermöglicht werden. Nach dem Vorbild der „Open University“[4] ist die Chance, sich unabhängig von seinem formalen Bildungsgrad lebenslang weiterbilden zu können, essenziell für die Informationsgesellschaft. Nach dem finnischen Vorbild sollen diese Online-Kurse auch in Österreich als Bestandteile von Studien- oder Ausbildungsleistungen anerkannt werden. Online-Ausbildungsangebote bieten darüber hinaus die Möglichkeit flexibler Umschulung in unterschiedlichsten Lebensphasen. Sie sind daher von besonderer Bedeutung angesichts der sich schnell ändernden Anforderungen an Arbeitnehmer. Auch Lehrer können MOOCs selbst zur Weiterbildung nutzen. Die finnische CODING Initiative[5] hat einen kostenlosen MOOC für Lehrer entwickelt, mit dem man sich notwendige Kompetenzen im Bereich des Programmierens aneignen kann.
Personalisierte Bildung ermöglichen
Neue Technologien ermöglichen hochwertige und personalisierte Bildung, die auf die eigenen Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten ist. Auch in Österreich sollten US-amerikanische Pilotprojekte im Schul- und Universitätsbereich ähnlich der School of One erprobt werden. In jedem Bundesland könnten sich Schulen um die Stelle einer Pilotschule bewerben. Diesen würde die technische Infrastruktur, die personalisierten Unterricht in einem Beispielfach erlaubt, vom Staat oder Privaten zur Verfügung gestellt werden. An der New Yorker School of One ist es gelungen, durch die Anwendung von Big-Data-Algorithmen Inhalte des Mathematikunterrichts stark zu individualisieren. So wurde der gleiche Lehrinhalt den Schülern je nach deren Fähigkeiten in unterschiedlichen Formen und für deren besseres Verständnis vermittelt. Dadurch konnten die Erfolgsraten der Schüler erheblich gesteigert werden.
Digitale Stammdatenbank einführen
Die Speicherung und digitale Übermittlung medizinischer Stammdaten ermöglicht fortschrittliche Diagnosemethoden. Die Verfügungsgewalt der Patienten über ihre Daten bleibt garantiert; sie bestimmen selbst, ob ihre Daten genutzt werden dürfen oder nicht. Daher ist eine Aufklärung der Patienten über den gesellschaftlichen Nutzen von Patientendaten unerlässlich.
Fußnoten
- Wired (2016). ↩
- Mannila (2016). ↩
- Rakuten (2016). ↩
- Die englische Open University ist die größte staatliche Universität in Europa. Für eine Großzahl der 70 Studiengänge bestehen weder physische Anwesenheitspflicht noch Aufnahmebedingungen. Lehrmittel werden kostenlos digital zur Verfügung gestellt und Studierende werden (persönlich oder über digitale Kommunikationskanäle) von Tutoren betreut. Die Open University gehört zu den weltweit besten Business Schools. ↩
- Koodiaapinen (2017). ↩
Mehr interessante Themen
Digitalpotenzial #1: Theorie & Praxis
Chancen und Risiken des digitalen Zeitalters
Zeiten großen technologischen Wandels sind Zeiten großer Verunsicherung. Dies gilt auch für die Digitalisierung. Wir Menschen fürchten uns vor Massenarbeitslosigkeit und hyperintelligenten Maschinen, die unser Leben bestimmen. Technologischer Wandel bringt aber auch enorme Möglichkeiten und Chancen, die von der Angst vor Veränderung verdeckt
Digitalpotenzial #2: Arbeit
Die Arbeitswelt von morgen (und übermorgen)
Die Digitalisierung macht vielen Menschen Angst. Ein Großteil hat Sorge, durch neue Technologien den Job zu verlieren. Ein seriöser Blick auf die Zukunft der Arbeit zeigt aber, dass jede technologische Revolution neue, zusätzliche Arbeitsplätze hervorgebracht hat. Welche Veränderungen uns erwarten – und warum diese keineswegs nur negativ sei
Digitalpotenzial #3: Verwaltung
Was Österreich von Estlands digitaler Verwaltung lernen kann
Viele Staaten stehen dem Wunsch des Bürgers nach zeitgemäßen Dienstleistungen ratlos gegenüber. Estland, ein kleines Land im Baltikum, hat vorgemacht, wie digitale Verwaltung aussehen kann.
Digitalpotenzial #4: Bildung
Raus aus der Kreidezeit – neu denken lernen
Neue Technologien erfordern und ermöglichen ein neues Denken. Daraus ergeben sich auch neue Wege in der Bildung. Es wird Zeit, dass wir uns auf die Reise machen.