Handlungsempfehlungen
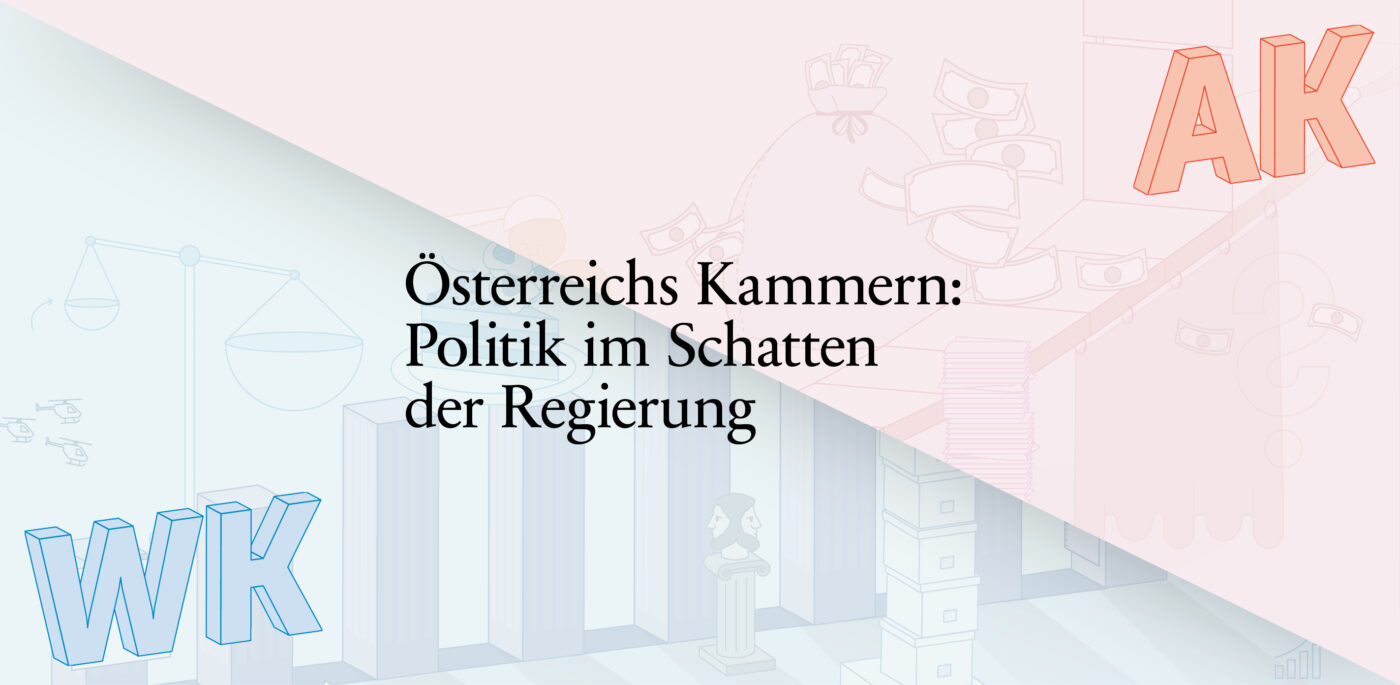
- 22.11.2019
- Lesezeit ca. 3 min
Politik im Schatten der Regierung
Kein Zwang: Statt einer Pflichtmitgliedschaft braucht es in einem Rechtsstaat eine unbürokratische Möglichkeit des Ausstiegs. Wer die Leistungen der Arbeiter- bzw. Wirtschaftskammer nicht in Anspruch nehmen möchte, sollte auch nicht dafür bezahlen müssen.
Beitragssenkung: Die Bundesregierung hat den Kammern das Vertretungsmonopol aber bereits zugesichert. Im Gegenzug sollten sich die Pflichtmitglieder aber geringere Beiträge erwarten dürfen.
Transparenz: Wer Zwangseinnahmen verwaltet und ausgibt, muss genau und zeitnah aufschlüsseln, wofür die Mittel eingesetzt werden. Aktuell muss man sich durch parlamentarische Anfragen arbeiten, um zu erfahren, wie das Geld aus den Pflichtbeiträgen genau eingesetzt wird. Für eine aufgeklärte Öffentlichkeit muss es Standard werden, dass sie sich jederzeit über das Gebaren der Kammern ein Bild verschaffen kann. Der Rechnungshof sollte umfassend prüfen und die Berichte auch verpflichtend veröffentlichen.
Trennung von Interessenvertretung und Politik: Eine stärkere Unabhängigkeit der Kammern von der Politik sollte dazu führen, dass sie ihre Funktion als beratendes und evaluierendes Gremium besser wahrnehmen können. Will die Kammer eine Selbstverwaltung ohne politische Einmischung, sollte sie sich auch nicht auf der Regierungsbank oder im Parlament wiederfinden.
Fokus: Die Kammern nehmen heute zu viele, weit über ihre eigentlichen Funktionen hinausgehende Aufgaben wahr. So sitzen ihre Funktionäre unter anderem im Beirat für Metrologie oder auch für historische Fahrzeuge. Einige Aufgaben gehören zu ihren Kernkompetenzen, wie die Interessenvertretung oder die Lohnverhandlungen, doch ihr Mitmischen im politischen Leben, der Gesetzgebung und der Unternehmenstätigkeit im Bildungsbereich nimmt einen zu großen Teil ein.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





