Österreich in der Corona-Krise
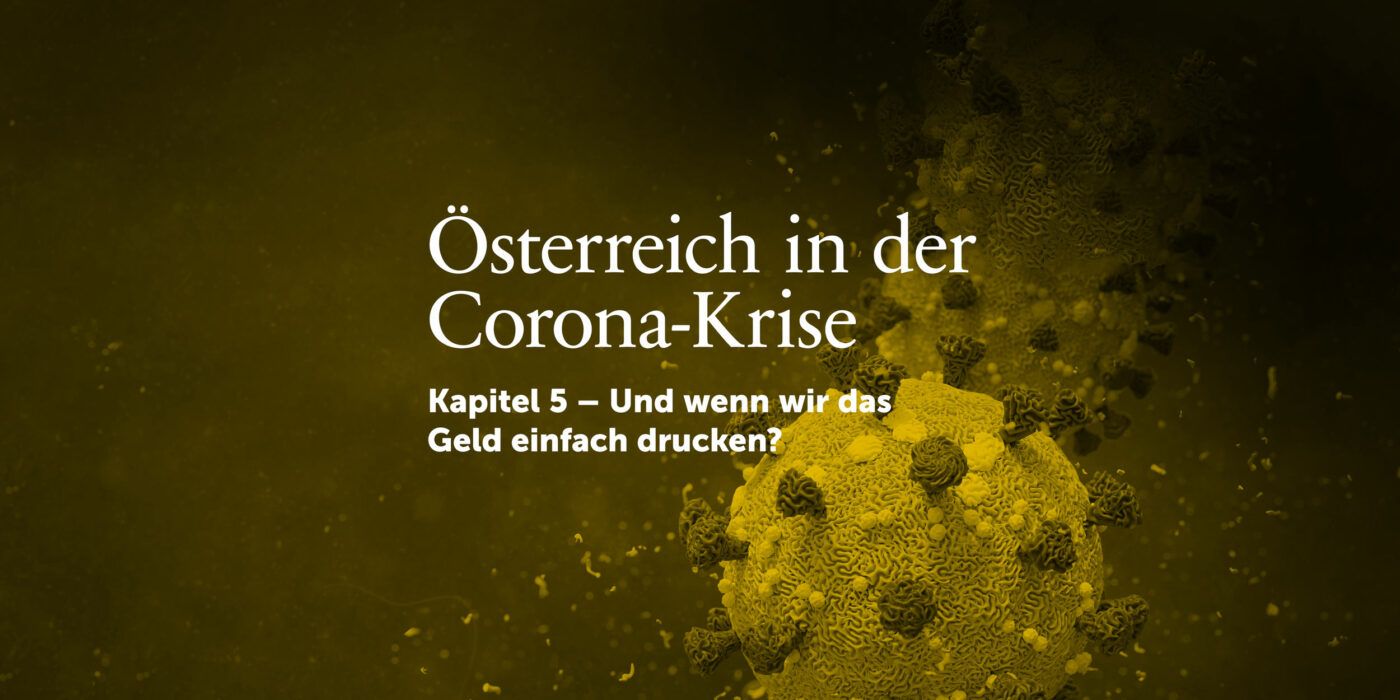
- 12.05.2020
- Lesezeit ca. 5 min
Kapitel 5: Und wenn wir das Geld einfach drucken?
Wie MMT in der Vergangenheit umgesetzt wurde
Die Verwendung des Worts „modern“ lässt vermuten, dass es sich bei MMT um ein völlig neuartiges Konzept handelt. Das ist aber nicht ganz richtig. Im folgenden Abschnitt werden Beispiele genannt, die MMT schon sehr, sehr nahe kommen. Überraschend ist, dass MMT, obwohl oft vom linken politischen Spektrum propagiert, nicht nur von dieser Seite umgesetzt wurde. Unter den folgenden drei Beispielen findet sich auch eines von Deutschland während des Regimes der Nationalsozialisten:
Großbritannien im ersten Weltkrieg
1914 wurden den britischen Bürgern von einem Tag auf den anderen, wenn sie Geld von der Bank behoben, nicht Pfund, sondern sogenannte „Bradbury Notes“ ausgehändigt. Großbritannien verfolgte bis 1931 noch den Goldstandard. Das bedeutet, dass das Pfund zu einem fixen Kurs in Gold umgewechselt werden konnte. Weil Großbritannien aufgrund der knapp werdenden Goldreserven im Ersten Weltkrieg vermeiden wollte, dass Bürger ihr Geld in Gold umwechselten, führte das Finanzministerium die „Bradbury Notes“ ein, die nicht in Gold umgewechselt werden konnten.
Diese „Bradbury Notes“ wurden zur gesetzlich vorgeschriebenen Währung und vom britischen Finanzministerium gedruckt, da die Bank of England (BoE) dies in der Eile nicht geschafft hatte. Da in diesem Fall das Finanzministerium gleich der Zentralbank war, die eine neue Währung ausgegeben hat, kann dies als MMT bezeichnet werden. In den 1920er-Jahren konnte dann wieder auf die normale Währung umgeschwenkt werden und zum Goldstandard zurückgekehrt werden. Das Experiment war grundsätzlich geglückt, denn die Währung wurde angenommen ohne eine Hyperinflation auszulösen, da die Bevölkerung von Anfang an Vertrauen in die neue Währung und diese sofort angenommen hatte. In der Zeit der Bradbury Notes wurde der Goldstandard in den meisten großen Volkswirtschaften hoch gehalten und eine Rückkehr zu diesem nach dem Krieg wurde erwartet. In der heutigen Zeit, in der die meisten Währungen nur auf Vertrauen basieren, ist ein Vertrauensverlust wahrscheinlicher, da eine Rückkehr z.B. zu einem verlässlichen Goldstandard nicht erwartet wird. Wird die Verlässlichkeit der Währung einmal in Frage gestellt, wird es Staaten und Zentralbanken schwer fallen, den Bürgern Vertrauen in eine solche Verlässlichkeit zu vermitteln.
Deutschland in den 1930ern
Ähnlich wie Großbritannien im Ersten Weltkrieg versuchte sich auch das NS-Regime am Gelddrucken durch die Einführung einer neuen Währung. Hjalmar Schacht, zuerst Reichsbankpräsident und danach Reichswirtschaftsminister unter Hitler, war für die Einführung der sogenannten Mefo-Wechsel zuständig, die 1933 bis 1939 im Umlauf waren. Die Mefo-Wechsel wurden eingesetzt, um Rüstungsinvestitionen zu finanzieren, ohne sich weiter verschulden zu müssen. Die Funktionsweise war simpel: Der Staat bezahlte die Unternehmen mit Mefo-Wechseln, die diese Wechsel wiederum bei ihrer Privatbank in Reichsmark umwandeln konnten. Die Privatbanken konnten diese Wechsel dann bei der Reichsbank in Reichsmark umtauschen. Um die Banken vom Umtausch abzuhalten, wurden die Wechsel mit 4 Prozent Jahreszinssatz verzinst. Aufgrund dieser Verzinsung übernahmen die Mefo-Wechsel bald den Charakter einer zusätzlichen Währung und wurden zwischen Unternehmern oft wie eine tatsächliche Währung verwendet.
Bis 1938 wurden solcherart Mefo-Wechsel im Wert von 12 Milliarden Reichsmark ausgegeben. Nachdem Schacht kurz vor seinem Rücktritt die weitere Finanzierung 1939 durch Mefo-Wechsel verhindert hatte, wurden andere Methoden eingesetzt, um Unternehmen zu bezahlen. Zum Beispiel wurden Staatsanleihen mit halbjähriger Laufzeit ausgegeben oder Steuergutscheine verteilt. Bis nach Ende des Krieges wurden so durch Gelddrucken Investitionen getätigt. Aufgrund des Aufbaus der staatlichen Gesellschaft, die diese Mefo-Wechsel ausgab, konnten die Schulden aufgrund der Verrechnungsmethode im Staatsbudget verschleiert werden. Die fehlende Hyperinflation konnte insbesondere abgewendet werden, da sowohl Preise als auch Löhne strikt gedeckelt wurden. Diese verschiedensten Möglichkeiten zur Staatsfinanzierung wurden bis zum Ende des Krieges weitergeführt.
Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk beschrieb in einen Brief an Hitler 1938, dass die Mefo-Wechsel zur Finanzierung der Rüstungsausgaben eingesetzt werden sollten. Womit es sich um Geldschöpfung handelte – also um das Drucken von Geld. Das Finanzministerium gab eine Art Währung aus und versuchte, den Umtausch in Reichsmark zu verhindern. Das Beispiel zeigt allerdings auch, dass die Politik einen starken Anreiz bekommt, übermäßig viel Geld auszugeben und den Bezug zu nachhaltiger Finanzpolitik aus den Augen verliert.
Chile
Chile ist nur eines von vielen lateinamerikanischen Beispielen, die MMT-ähnliche Experimente durchgeführt hatten. Chile versuchte das Konzept in den 1970er-Jahren umzusetzen, Peru und Argentinien in den 1980ern.
In Chile konnte gleichzeitig mit einem starken Anstieg des Budgetdefizits eine Explosion der Geldmenge beobachtet werden. Einer der Ökonomen hinter Salvador Allende gab sogar zu, dass die Geldpolitik das Budgetdefizit finanziert hätte. Während die staatlichen Investitionen zuerst tatsächlich Arbeitslosigkeit reduziert hatten, war dieser Erfolg nur von kurzer Dauer: Bald danach wurden die ersten Flaschenhälse in einige Sektoren sichtbar, das Vertrauen in die Währung sank und die Bürger flüchteten aus dem Escudo. Wie oben bereits erklärt, verschwand die Nachfrage in die Währung zwar nicht völlig, weil ja die Steuern noch in der Landeswährung bezahlt werden mussten. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Währung ging allerdings verloren, Hyperinflation war die Folge.
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





