Schutz der Konsumenten – oder der Unternehmer?
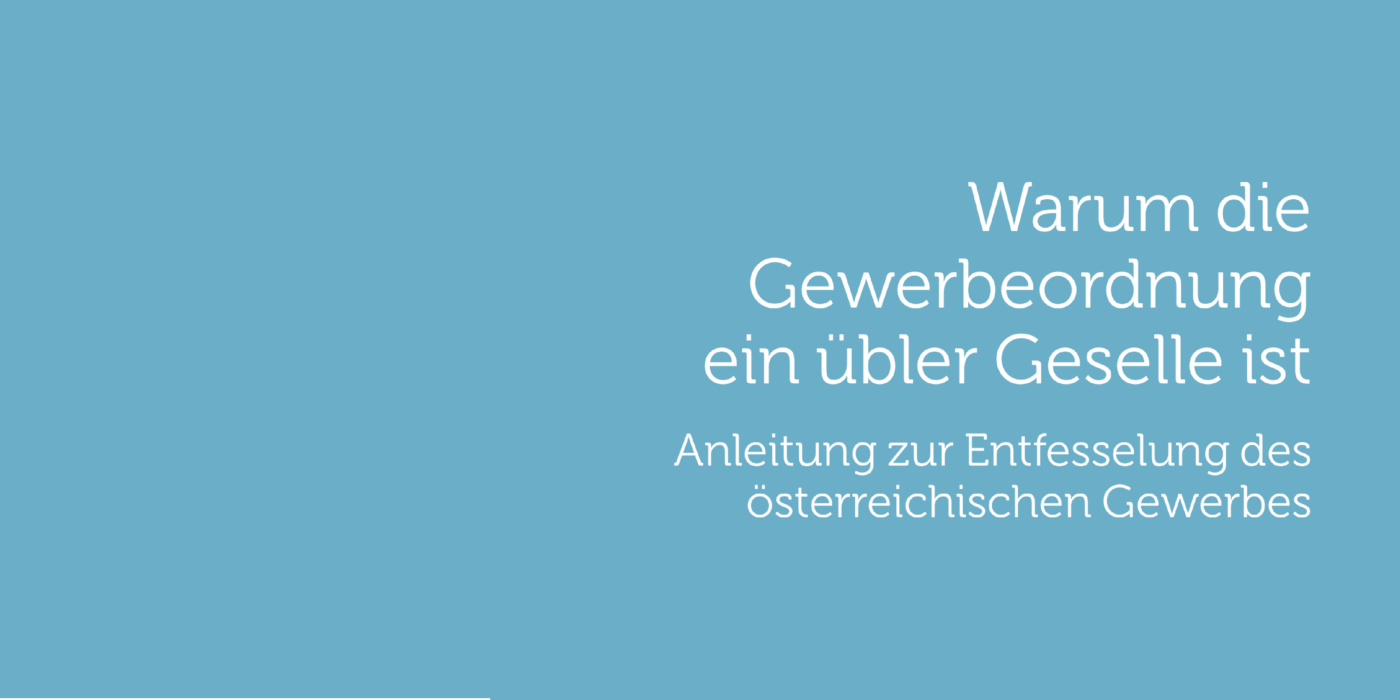
- 17.08.2016
- Lesezeit ca. 2 min
Anleitung zur Entfesselung des österreichischen Gewerbes
Was die österreichische Bundesregierung auch tut, um die Lage der Menschen zu verbessern – immer ist jede Menge Geld im Spiel. Ob es nun um die Belebung der flauen Konjunktur geht, um das Abschwächen der wachsenden Ungleichheit, um das Zurückdrängen der Arbeitslosigkeit oder um die Förderung von Jungunternehmen: Die öffentliche Hand zeigt sich auf Rechnung ihrer Bürger großzügig und öffnet deren Brieftaschen.
Derzeit stehen Unternehmensgründer hoch im Kurs, jedem Gründungswilligen soll öffentliches Geld in die Hand gedrückt werden, wenn er ein junges, innovatives Start-up eröffnet.
Die Mittel werden ihre Abnehmer finden, daran besteht kein Zweifel. Dabei gäbe es auch eine Reihe von Erleichterungen, die nicht sehr viel kosten, aber sehr viel unternehmerische Dynamik entfalten könnten. Etwa, wenn der gesetzgebende Staat die Gewerbeordnung an die Erfordernisse des dritten Jahrtausends anpasste. In keinem westeuropäischen Industrieland müssen Selbständige so oft und so ausführlich nachweisen, für ihre unternehmerische Tätigkeit auch geeignet zu sein. Hierzulande wird nicht nur die Ausübung von 80 Gewerben streng reguliert, selbst Tätigkeiten freier Gewerbe werden bis ins kleinste Detail beschrieben.
Eingeführt wurde die Gewerbeordnung im Jahr 1859 mit dem Ziel, „die gewerbliche Betriebsamkeit in unserem Reiche gleichmäßig zu regeln und möglichst zu erleichtern…“ (Kundmachungspatent). Nun hat sich das mit dem Reiche mittlerweile erledigt – das mit der Erleichterung ebenso. Durch die enorme Überfrachtung im Laufe der Jahrzehnte wurde das ursprüngliche Ziel aus den Augen verloren. Wer Unternehmer sein darf und wer nicht, bestimmt in Österreich letzten Endes die Wirtschaftskammer – also die eigene Standesvertretung und damit die angestammten Betriebe. Hier gilt es abzuwägen: Jedes neues Mitglied erhöht die Einnahmen der Kammern, stellt aber auch eine Bedrohung für die Existenz bereits etablierter Unternehmen dar. Begründet wird die Notwendigkeit einer strengen Regulierung vor allem mit dem Schutz des Konsumenten. Nur wer eine Meisterprüfung abgelegt hat, ist auch imstande, den Verbrauchern in sensiblen Geschäftsbereichen die nötige Qualität zu bieten. Das Argument hat etwas für sich – ignoriert aber einen wichtigen Umstand: Der Gewerbeinhaber[1] muss den Nachweis erbringen, aber nicht seine Mitarbeiter, die den Kunden versorgen. Nehmen wir nur das Beispiel eines Optikers: Niemand wird bestreiten wollen, dass die Tätigkeit im Interesse der Kunden jede Menge Fachwissen verlangt und zweifellos zu jenen Gewerben zählt, deren Ausübung strengen Regulierungen zu unterliegen hat. Um das Optiker-Gewerbe auszuüben, braucht es deshalb auch eine Meisterprüfung – aber keine Anwesenheitspflicht des Meisters. Nur so konnten sich große Optik-Ketten in Österreich etablieren, unzählige Standorte teilen sich einen Meister. In welcher Filiale dieser gerade anwesend ist, weiß niemand. Es fragt auch bei Betreten einer Filiale niemand, ob der Meister gerade da ist, weil davon auszugehen ist, dass dies der Fall ist. Wie es aussieht, dürfte das in der Praxis auch ganz gut funktionieren.
Interessant ist weiters, dass es in Österreich 609.618 Gewerbeberechtigte gibt – und 800.258 Gewerbescheine.[2] Für jeden Gewerbeschein wird Kammerumlage fällig, was vielleicht einen Hinweis darauf geben soll, warum ein Unternehmen, das Gebäude außen und innen (Fenster und Stiegenhäuser) reinigt, zwei Gewerbescheine benötigt. Einen für das regulierte Gewerbe, einen für das freie. Zwei Gewerbescheine, zweimal Kammerumlage. Es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, dass die strenge Regulierung nicht so sehr die Verbraucher im Auge hat – sondern vielmehr die eingesessenen Unternehmen, denen neue Konkurrenz vom Leibe gehalten werden soll. Sehr zum Vorteil auch der Wirtschaftskammern, die mit kontinuierlich steigenden Einnahmen versorgt werden.
Fußnoten
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





