Preis- und Lohnerhöhungen
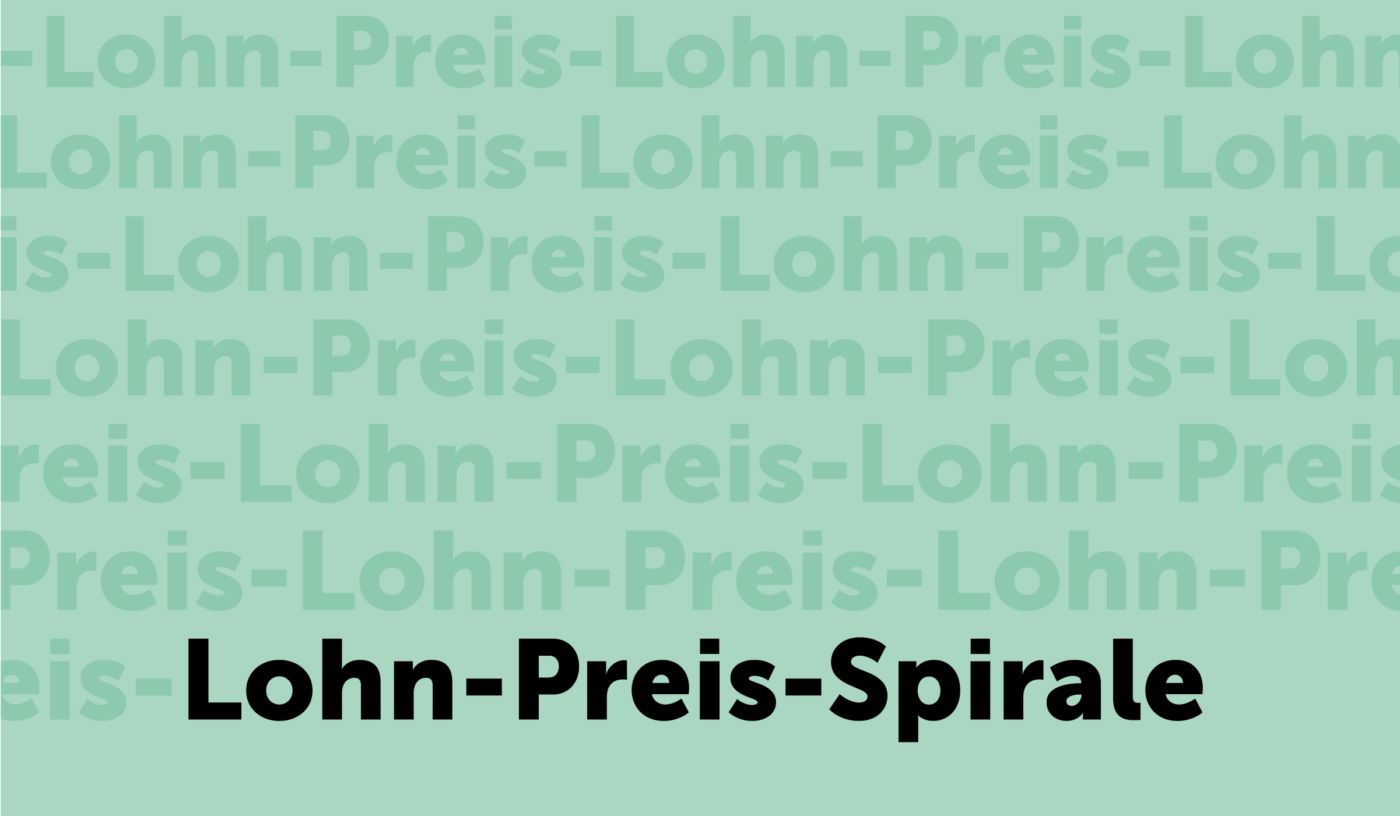
- 16.09.2022
- Lesezeit ca. 6 min
Indiz 3: Preiserhöhungen werden bei hoher Inflation schneller weitergegeben.
In Zeiten mit geringer Inflation und hoher Konkurrenz können Unternehmen steigende Preise für Vorleistungen nicht einfach an ihre Kunden weitergeben. Sie suchen sich lieber billigere Lieferanten oder versuchen, in der Produktion einzusparen, statt Kunden an Mitbewerber zu verlieren. Wenn Unternehmer damit rechnen, dass die Preise ohnehin bald wieder sinken, werden sie kurzfristig auch ihre Gewinnmarge reduzieren.
Ist die Inflationserwartung jedoch so hoch wie jetzt, versuchen Unternehmen, die Preise so schnell wie möglich zu erhöhen. Das umso mehr, wenn das Angebot die Nachfrage nicht decken kann. Häufig wird in diesem Zusammenhang von Spekulation oder dem schnellen „Körberlgeld“ gesprochen. Zweifellos gibt es Anbieter, die gar keine höheren Kosten haben und dennoch die Preise anheben. Vielen Unternehmern bleibt aber gar nichts anderes übrig, als ihre Inflationserwartungen einzukalkulieren, weil sie sich oft selbst an langfristige Verträge zu vereinbarten Preisen binden müssen und es sich nicht leisten können, von weiter steigenden Preisen überrascht zu werden. Der Wettbewerb kann diese Entwicklung nicht abbremsen, da alle Unternehmen in der gleichen Situation sind.
Auch in der Eurozone gibt es Anzeichen, dass steigende Arbeitskosten bei hohen Inflationsraten stärker weitergegeben werden als in Zeiten unterdurchschnittlicher Inflation.[1] Derzeit erwarten Unternehmen zudem, dass die EZB die Zinsen erhöhen muss und sich somit die Kreditbedingungen verschlechtern werden. Daraus ergeben sich negative Auswirkungen auf zukünftige Gewinne, die mit höheren Preisen kompensiert werden sollen. Hinzu kommt die allgemein hohe ökonomische Unsicherheit, die dazu führt, dass Unternehmen Lohnerhöhungen nicht einfach abfedern wollen. Agustín Carstens – Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel – hat gezeigt, dass sich die jüngsten Lohnerhöhungen in den Industrieländern schon deutlich stärker in der Preisentwicklung niederschlagen, als das in den letzten Jahren der Fall war. Er leitet daraus die Sorge ab, dass uns die Inflation wieder länger begleiten könnte.
Indiz 4: Leitbranchen preschen mit kräftigen Lohnerhöhungen vor.
Im Hinblick auf eine beginnende Lohn-Preis-Spirale müssen bestimmte Branchen genauer beobachtet werden als andere. Wie unterschiedlich einzelne Branchen auf die gesamte Lohnentwicklung wirken, zeigt Abbildung 5 anhand der Entwicklung der Tariflöhne in Österreich seit 2016, jeweils für die Industrie, den Handel und insgesamt. Man erkennt deutlich, dass die Lohnrunden in der Industrie eine wegweisende Funktion für den Rest der Wirtschaft haben. Die Lohnverhandlungen in der Industrie finden überwiegend im Frühjahr und im Herbst statt. Alle anderen Sektoren ziehen dann nach; deren Abschlüsse sind aber fast nie höher als jene in der Industrie. Ganz anders sieht die Situation im Handel aus. Dort wird am Jahresende verhandelt; die Abschlüsse führen aber meist nur zu einer Annäherung an den Gesamtindex und überschreiten ihn nicht.
Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Industrie treiben also die Lohnentwicklung, während die meisten anderen Branchen nur nachlaufen.[2] Schon im Frühjahr gab es hier hohe Abschlüsse und das Lohnwachstum war über den Sommer nicht so flach wie in den Vorjahren. Der Abstand zwischen den Tariflöhnen in der Industrie und jenen in anderen Branchen ist schon vor der aktuellen Herbstrunde ungewöhnlich hoch.
Die Industrie hat die Preise im laufenden Jahr bereits spürbar erhöht. Im (deutlich größeren) Dienstleistungssektor stiegen die Preise bislang aber weniger stark. Da dort aber wegen des allgemeinen Arbeitskräftemangels vergleichbare Lohnabschlüsse erzielt werden müssen, kann das ab nächstem Jahr einen erheblichen Druck auf die Dienstleistungspreise auslösen. Das wäre ein möglicher Einstieg in die Lohn-Preis-Spirale.
Übrigens: Die Tatsache, dass manche Sektoren – zum Beispiel die Industrie – nur relativ geringe Arbeitskostenanteile aufweisen, heißt nicht, dass Lohnerhöhungen dort nicht zu Preissteigerungen führen würden. Wichtiger scheint zu sein, wie stark der betreffende Sektor dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist, wie hoch die Lohnflexibilität ist, wie viel Personalfluktuation es gibt.[3]
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen 'Abbildung 5: Entwicklung der nominalen Tariflöhne in Österreich
Fußnoten
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





