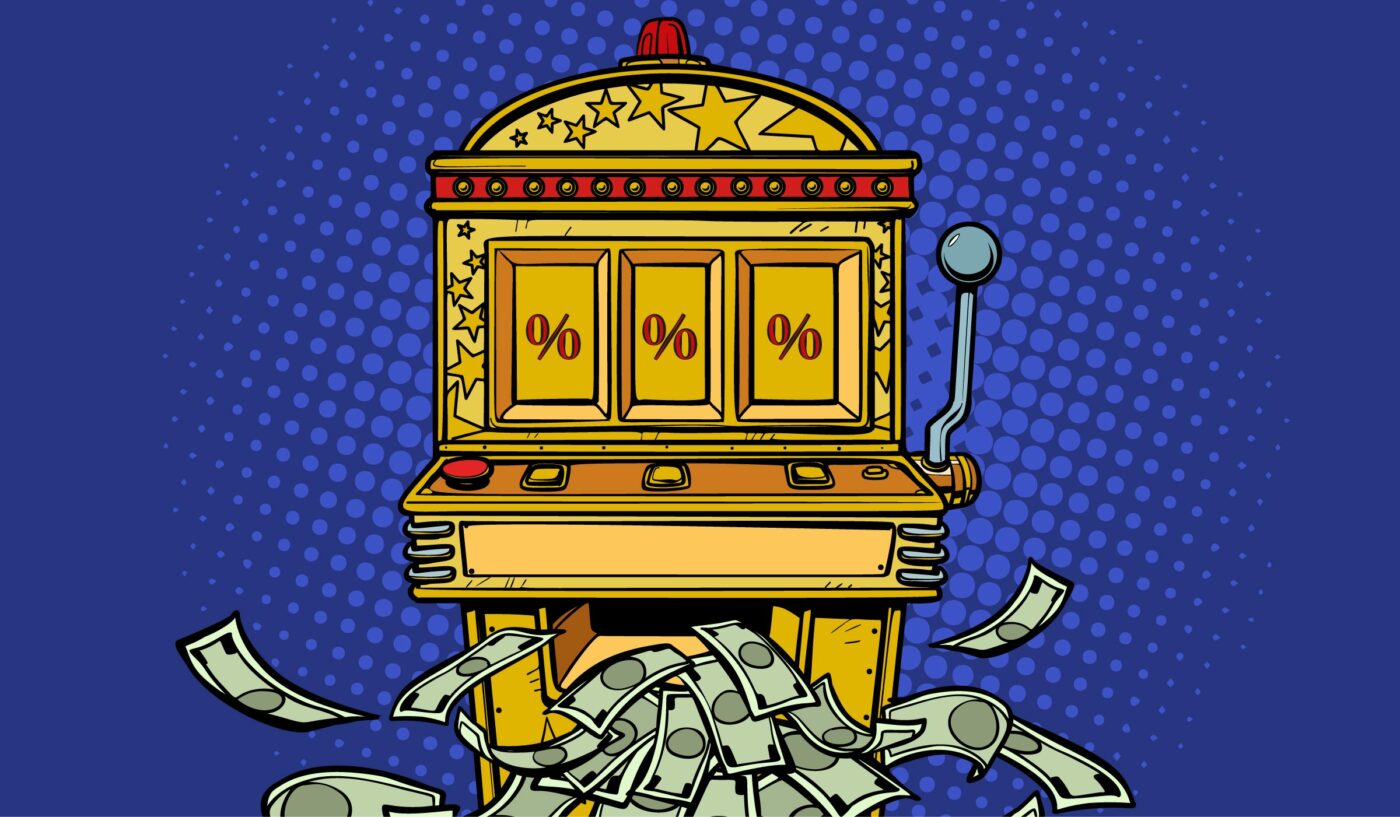Die gigantische Zinswette mit offenem Ausgang
- 04.01.2021
- Lesezeit ca. 6 min
Die Pandemie hat Österreich in eine wirtschaftliche Fantasiewelt befördert und stellt uns vor die Frage: Wie kommen wir von den Schulden runter?
Diese Pandemie gefährdet nicht nur unsere körperliche Gesundheit, sie greift auch unseren Hausverstand an. Die Ansprüche der Bürger an den Staat steigen ins Unermessliche und mittlerweile gibt es auch kaum noch ein Problem, für dessen Lösung sich der Staat nicht zuständig erklärte. Kein Arbeitsplatz darf verloren gehen, kein Unternehmen darf pleitegehen, kein Künstler darf das Schließen seiner Spielstätte spüren, keine Gemeinde darf finanziell unter der Krise zu leiden haben. Nun ist es völlig richtig, dass sich ein Staat verschuldet, um die Folgen einer derart schweren Pandemie abzufedern. Wann, wenn nicht jetzt? Die Sache geht nur schön langsam ziemlich ins Geld. Allein bis 2024 wird der Schuldenstand der Republik um 100 Milliarden oder ein Drittel steigen. Was wiederum viele Bürger zur bangen Frage führt, wie wir von diesen gigantischen Schuldenbergen jemals wieder runterkommen sollen.
Aus Sicht einiger Ökonomen ist das die völlig falsche Fragestellung. Angesichts des Zinsumfelds sei es nicht nur völlig ungefährlich, wenn sich der Staat immer weiter verschulde. Es sei vielmehr seine Pflicht, sich noch deutlich mehr von dem scheinbar unbegrenzt sprudelnden Gratis-Geld zu holen. Um von den Kosten der Coronakrise über weitere Sozialausgaben, höhere Pensionen, das bedingungslose Grundeinkommen bis hin zu den nötigen Investitionen für die Bewältigung des Klimawandels alles zu bezahlen, was gewünscht wird. Die Europäische Zentralbank druckt das benötigte Geld ganz einfach.
Man sieht: Diese Pandemie hat uns in eine wirtschaftliche Fantasiewelt befördert, aus der wir nur schwer wieder rausfinden werden. Zumal die Proponenten der enthemmten Staatsverschuldung ein Argument auf ihrer Seite haben: Der Staat Österreich wird in den kommenden Jahren immer weniger Geld für die Zinsen seiner Verbindlichkeiten aufwenden müssen, obwohl diese regelrecht explodieren. Wie das geht? Die Republik zahlt alte Schulden (mit höheren Zinsen) zurück, indem sie neue Schulden zu Null-Zinsen aufnimmt.
Ein gutes Geschäft. Aber wo wird dieses Experiment enden? Niemand weiß, wie hoch die Zinsen für Österreichs Staatsschulden in 10, 15 oder 20 Jahren sein werden. Niemand weiß, wie viel Geld die Schuldenberge dann kosten werden. Vielleicht bleiben die Zinsen niedrig, vielleicht steigen sie deutlich an, weil der Schuldner Österreich sich übernommen hat und an Glaubwürdigkeit verliert. Das kann über Nacht gehen. Mit anderen Worten: Der Staat hat eine gigantische Zinswette laufen, deren Ausgang völlig offen ist.
Klar ist hingegen, wem die Rechnung am Ende zugestellt wird: uns allen. Im besten Fall kommen wir mit einer Wachstumsdelle davon, die in ein paar Jahren keine Rolle mehr spielt. Im schlimmsten Fall mit einem dauerhaften Verlust von Wohlstand. Es liegt mehr oder weniger an uns. Die Arbeiterkammer sieht das anders, sie will die Reichen zahlen lassen und hat – wieder einmal – eine Kampagne für die Einhebung von Vermögensteuern lanciert. Nun kann man ja durchaus für die Besteuerung von Vermögen sein, ohne gleich ganz links zu stehen. Wissen sollte man aber, dass der ganz große Teil der heimischen Vermögen nicht auf Konten herumliegt, sondern in heimischen Unternehmen „arbeitet“.
Allein heuer wird das Eigenkapital in fast allen Betrieben von den anfallenden Verlusten stark geschwächt. Dieses dahinschmelzende Kapital jetzt mit Substanzsteuern weiter zu reduzieren, käme einer Schocktherapie mit schweren Nebenwirkungen gleich. Die Investitionskraft der Betriebe würde sinken, der Druck, die Produktionen in andere Regionen dieser Welt zu verlagern, steigen. Vermögensteuern würden so zum Brandbeschleuniger. Abgesehen davon sprechen alle Erfahrungen klar dagegen. Überall waren die Kosten höher als die Einnahmen, weshalb sich so gut wie alle Länder davon verabschiedet haben. Zuletzt war es Frankreich, das eine Kapitalflucht der Sonderklasse erlebte. Ungeachtet dessen wird uns die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften unverdrossen als Teil der Lösung verkauft werden. Immer und immer wieder. Wir werden eine Milchmädchenrechnung nach der anderen sehen und von fantastischen Summen hören. Aber es ist ein kostspieliger Irrweg.
Deutlich erfolgreicher war in der Vergangenheit die Kombination aus Wachstum und strikter Ausgabenkontrolle. Auch wenn es viele nicht hören wollen: Ohne rasche Rückkehr auf den Wachstumspfad ist ein Leben in Wohlstand und sozialer Sicherheit nicht denkbar. Gerade diese Krise zeigt, welch verheerende Wirkung eine schrumpfende Wirtschaft entfaltet. Wenn diese Pandemie ihr Ende findet, brauchen wir also kräftiges Wachstum. Dauerhaft. Wächst die Wirtschaft nämlich schneller als die Verbindlichkeiten, reduzieren sich die Schuldenquoten automatisch – und wir kommen langsam, aber relativ bequem von den hohen Schuldenbergen runter. Fallen die Wachstumsraten aber zu schwach aus, werden die Schulden zur Gefahr. Sie nähren die Zweifel, dass Österreich seine Schulden wieder zurückführen beziehungsweise unter Kontrolle halten kann. Inflation und steigende Zinsen wären die Folge.
Um nach der Krise schnell zu starkem Wachstum zu kommen, müsste die Regierung in der Pandemie Betrieben gezielter helfen. Und kürzer. Wir dürfen nicht riskieren, in einer „Zombie-Wirtschaft“ aufzuwachen. Einer Welt, in der viele Betriebe nur noch deshalb am Leben sind, weil sie der Staat vor dem Untergang bewahrt. Diese „Zombies“ würden das Wachstum bremsen, so wie das in Italien schon vor der Krise zu sehen war. Wir müssen verstehen, dass der Staat nicht jeden Betrieb retten kann.
Zudem sollten wir wichtige Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Nur so kommen wir besser in die Zukunft. Eine davon wäre: Der Staat kann sich zwar weiter verschulden – aber nicht mehr blind. Das Geld soll gezielt in die Bereiche von morgen gehen, wie die Digitalisierung der Schulen und der öffentlichen Verwaltung. Flankierend dazu braucht es nach überwundener Krise strikte Ausgabenkontrollen, die Schweden und Dänen haben es vorgemacht. Deren Schulden sind bei ähnlich hohen Steuern und Abgaben nur halb so hoch wie jene von Österreich. Weil beide Staaten in guten Zeiten verlässlich Überschüsse erwirtschaftet haben, mit denen sie ihre Schulden reduzierten.
Schweden hat in den vergangenen 25 Jahren 13 Budgetüberschüsse erzielt, Österreich einen einzigen. Das muss sich ändern. Voraussetzung dafür ist, dass der Staat seine großen Kostentreiber in den Griff bekommt. Allen voran den Pensionsbereich. Um die jährlichen Defizite im staatlichen Pensionssystem abzudecken, werden in den kommenden vier Jahren 64 Milliarden Euro benötigt. Weitere 54 Milliarden Euro fallen an, um die Beamtenpensionen auszahlen zu können. Macht in Summe 118 Milliarden Euro, die bis 2024 unter dem Kapitel Alterssicherung zu stemmen sind. Das ist mehr, als für die gesamte Krisenbekämpfung eingesetzt wird.
Wir können uns den Fantasten mit den einfachen Lösungen anvertrauen und uns hemmungslos verschulden. Oder auf unseren Hausverstand hören. Wie gesagt: Es liegt an uns.
Essay von Franz Schellhorn in der „Kleinen Zeitung“ (01.01.2021)
Mehr interessante Themen
Beschäftigungsboom in der Stadt Wien
In den letzten Jahren hat man in Wien zwar kräftig Beamte abgebaut, doch die Zahl der Vertragsbediensteten hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.
Wo die Schulden pro Kopf besonders hoch sind
Allein von 2019 bis 2024 stiegen die Gemeindeschulden um fast die Hälfte. Pro Kopf sieht es im Land Salzburg und in Kärnten noch am besten aus.
Gemeindefinanzen: Überschuss war gestern, jetzt regiert das Defizit
Seit Beginn der Corona-Krise sind die Defizite der Gemeinden und Wiens deutlich gestiegen, lediglich unterbrochen von einer kurzen Verschnaufpause.
Mit Rekordeinnahmen in den Schuldenturm
Die Gemeindebudgets pfeifen aus dem letzten Loch. Mal wieder. In den beiden vergangenen Jahren haben die Gemeinden rekordverdächtige Defizite eingefahren.
Staatsausgaben, als wäre noch Krise
Finanzminister Markus Marterbauer hält heute seine erste Budgetrede – und wird sein 6,4-Milliarden-Sparpaket erläutern, das nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
Österreich lebt über seine Verhältnisse
Nicht die Einnahmen des Staates sind ein Problem (weil zu niedrig), sondern die Ausgaben (weil stets viel zu hoch).