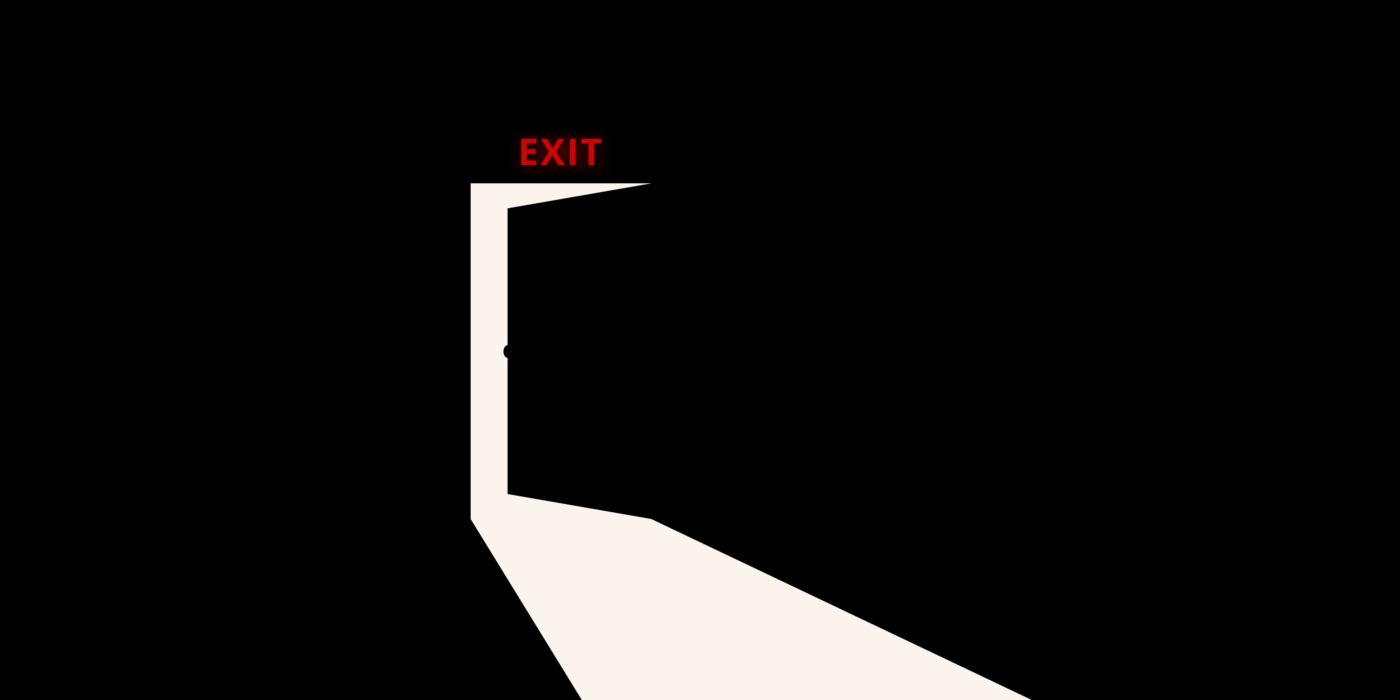Wer holt uns hier wieder heraus?
- 11.04.2020
- Lesezeit ca. 5 min
In der Stunde der Krise haben Zukunftsforscher Hochsaison. Vielleicht haben sie ja recht, wenn sie meinen, dass die Welt nach Corona nicht wiederzuerkennen sein wird. Dass die Globalisierung zurückgedrängt und wieder mehr vor Ort produziert wird, dass Billigflüge ihr Ende finden, ein neues Biedermeier kommt und der ohnehin schon recht starke Staat eine noch viel stärkere Rolle in unserem Leben einnimmt.
Viel wahrscheinlicher aber ist, dass alles ganz anders kommt. In etwa so, wie das der deutsche Publizist Gabor Steingart erwartet: Diese Krise ist kein großer Wendepunkt, sie wird bereits begonnene Entwicklungen radikal beschleunigen. Die Welt danach wird in erhöhtem Tempo globalisiert, politisch fragmentiert und technologisch digitalisiert sein.
Für ein kleines Land wie Österreich ist es in diesem Umfeld von entscheidender Bedeutung, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Aber wie macht man das? Am besten beginnt man damit, nicht mehr auf falsche Propheten zu hören. In den vergangenen Jahren wurde der Bevölkerung immer wieder erklärt, sie müsse sich vom „Wachstumszwang“ befreien, weil ja ohnehin nur einige wenige von dieser wachstumsgetriebenen Wirtschaft profitieren würden. Die aktuelle Notlage legt in erschreckender Klarheit offen, wie sehr unser aller Wohlstand von einer florierenden Wirtschaft abhängt. Sie nützt eben nicht den wenigen, sie nützt den vielen. Wachstum ist natürlich nicht alles, aber die Voraussetzung dafür, den ganzen Spuk mit all seinen Folgen zu bewältigen. Ohne Wachstum ist weder der Sozialstaat finanzierbar noch die Massenarbeitslosigkeit in den Griff zu kriegen noch eine Pleitewelle in bisher unbekanntem Ausmaß zu verhindern.
Derzeit kann niemand wirklich abschätzen, wie tief die wirtschaftliche Talfahrt sein wird und wann wir wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren können. Unübersehbar aber ist, dass sich die wirtschaftlichen Einschätzungen derzeit eher verschlechtern als verbessern. Die Eindämmung der Pandemie verläuft zäher als erwartet, und das Hochfahren der Wirtschaft ist viel komplexer als gedacht. Es wird keinen sprunghaften Anstieg der wirtschaftlichen Aktivitäten geben, sondern ein schrittweises Herantasten an das Zuvor.
Gebraucht sind schnelle Tests
Das alles macht das zentrale Ziel nur noch klarer: Alle Anstrengungen sind darauf zu richten, Gesunde so rasch wie möglich ihrer Arbeit nachgehen zu lassen, während Erkrankte und Risikogruppen isoliert werden. Das setzt schnelle und großflächige Tests voraus, um verlässliche Daten über die Verbreitung des Virus zu bekommen. Ganz nebenbei dürfen wir auch noch darauf hoffen, eines Morgens von der freudigen Nachricht überrascht zu werden, dass Wissenschaftler irgendwo auf dieser Welt einen Wirkstoff gefunden haben. Bis es so weit ist, bleibt Zuversicht die einzige Medizin. Mit verzweifelten Unternehmern und desperaten Beschäftigten wird diese Krise nicht zu überwinden sein. Deshalb brauchen die Menschen die Perspektive auf eine gedeihliche Zukunft in Wohlstand und Sicherheit. Sonst werden sie nicht konsumieren, nicht investieren und ihre Betriebe nicht mehr aufsperren.
Seit Beginn dieser Woche haben die Bürger zumindest die Aussicht auf eine langsame Lockerung der Beschränkungen. Das ist ein erster wichtiger Schritt, das viel zitierte kleine Licht am Ende des Tunnels. Warum ausgerechnet in dieser Phase der Beruhigung eine populistische Debatte über neue Substanzsteuern losgetreten wird, bleibt ein großes Rätsel. Bevor man darüber nachdenkt, wer den Wiederaufbau bezahlen soll, wäre es besser, sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, den von staatlichen Betriebsschließungen entfachten Brand entschlossen zu löschen. Zumal ja alle Beteiligten wissen, dass die großen Vermögen hierzulande nicht auf irgendwelchen Konten schlummern, sondern in heimischen Unternehmen stecken.
Keine Entschädigung
Nun kann man natürlich ganz grundsätzlich für die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften sein. Aber gerade jetzt? Man muss kein großer Bilanzexperte sein, um zu sehen, dass der Lockdown das Eigenkapital der Betriebe in atemberaubender Geschwindigkeit aufzehrt. Diese Kapitalvernichtung mit Substanzsteuern zu beschleunigen käme einem wirtschaftspolitischen Selbstmord gleich. Zumal die Verschuldung in den Unternehmen ohnehin explosionsartig steigen wird. Während die Kaufkraft der Arbeitnehmer großzügig über Kurzarbeitsprogramme abgesichert wurde, gibt es für Unternehmen keine Entschädigungen. Sie müssen die von staatlich verordneten Betriebsschließungen ausgelösten Verluste selbst tragen. Entweder, indem sie Reserven auflösen oder sich Geld leihen, für deren Rückzahlung der Staat freundlicherweise garantiert. Viele werden nicht zurückzahlen können, den anderen wird das Geld für Investitionen fehlen. Statt Kapital zu besteuern, sollte die Regierung alles Mögliche dafür tun, dass es in Österreich investiert wird – und nicht anderswo.
Starke stärker fordern
Womit wir wieder bei der Zuversicht wären. Das Ziel muss auch in Zukunft sein, die Schwächsten über einen starken Sozialstaat zu schützen. Gleichzeitig müssen wir alles dafür tun, das wirtschaftliche Potenzial des Landes zur vollen Entfaltung zu bringen. Das bedeutet auch, die Starken stärker zu fordern. Um nur ein Beispiel zu nennen: Österreich kann sich eine Gewerbeordnung, die im Stil mittelalterlicher Zünfte über den Markteintritt neuer Anbieter entscheidet, ganz einfach nicht mehr leisten. Dasselbe gilt für den strengsten Ladenschluss in ganz Europa. Alle Gründungswilligen brauchen einen erleichterten Neustart, Geschäfte sollen auf- und zusperren, wann die Betreiber und deren Beschäftigte das für gut und richtig halten.
Zudem muss der Staat die Digitalisierung im öffentlichen Bereich entschlossen vorantreiben. Nicht die Bedenken der Staatsbediensteten und deren Standesvertreter geben dabei Orientierung, sondern die Bedürfnisse der Bürger. Bereits jetzt muss mit Hochdruck daran gearbeitet werden, den Bildungsbereich in das neue Jahrtausend zu führen. Damit unsere Kinder im Fall eines weiteren Lockdown im digitalen Klassenzimmer unterrichtet werden können. So wie das Länder wie Israel und Estland bereits machen.
In Zeiten wegbrechender Steuereinnahmen und explodierender Staatsausgaben ist es richtig, nicht mit Sparprogrammen gegenzusteuern. Aber im nächsten Aufschwung muss das Land zu einer soliden Haushaltspolitik zurückkehren. Weil Länder, die in wirtschaftlich guten Jahren mit Überschüssen alte Schulden zurückgezahlt haben, in der Not in die Vollen gehen können. Beste Beispiele dafür sind Schweden, Dänemark, die Schweiz, aber auch Deutschland, das sich jahrelang für seine Politik der schwarzen Null kritisieren lassen musste. Es ist nämlich von entscheidender Bedeutung, dass Österreich jetzt die Weichen in die richtige Richtung stellt.
Gastkommentar von Franz Schellhorn in der „Presse“ (11.04.2020)
Mehr interessante Themen
Wir sehen: Längeres Arbeiten ist möglich! Senioritätsprinzip bremst Ältere aus
Der österreichische Arbeitsmarkt zeigt, dass höhere Beschäftigung im Alter möglich ist: Seit der schrittweisen Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters für Frauen ist die Zahl der 60-jährigen weiblichen Erwerbstätigen um fast 75 Prozent gestiegen.
Beschäftigungsboom in der Stadt Wien
In den letzten Jahren hat man in Wien zwar kräftig Beamte abgebaut, doch die Zahl der Vertragsbediensteten hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.
Die Welt war noch nie schlimmer: Warum unser Bauchgefühl oft lügt
Die Welt wird immer schlechter, die Reichen immer reicher: Warum uns unser Bauchgefühl in die Irre führt und wie gefährlich Halbwissen für die Politik ist.
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Gemeindefinanzen: Überschuss war gestern, jetzt regiert das Defizit
Seit Beginn der Corona-Krise sind die Defizite der Gemeinden und Wiens deutlich gestiegen, lediglich unterbrochen von einer kurzen Verschnaufpause.
Wo die Schulden pro Kopf besonders hoch sind
Allein von 2019 bis 2024 stiegen die Gemeindeschulden um fast die Hälfte. Pro Kopf sieht es im Land Salzburg und in Kärnten noch am besten aus.