Wie verträgt sich das (alte und neue) Lehrerdienstrecht mit mehr Schulautonomie?
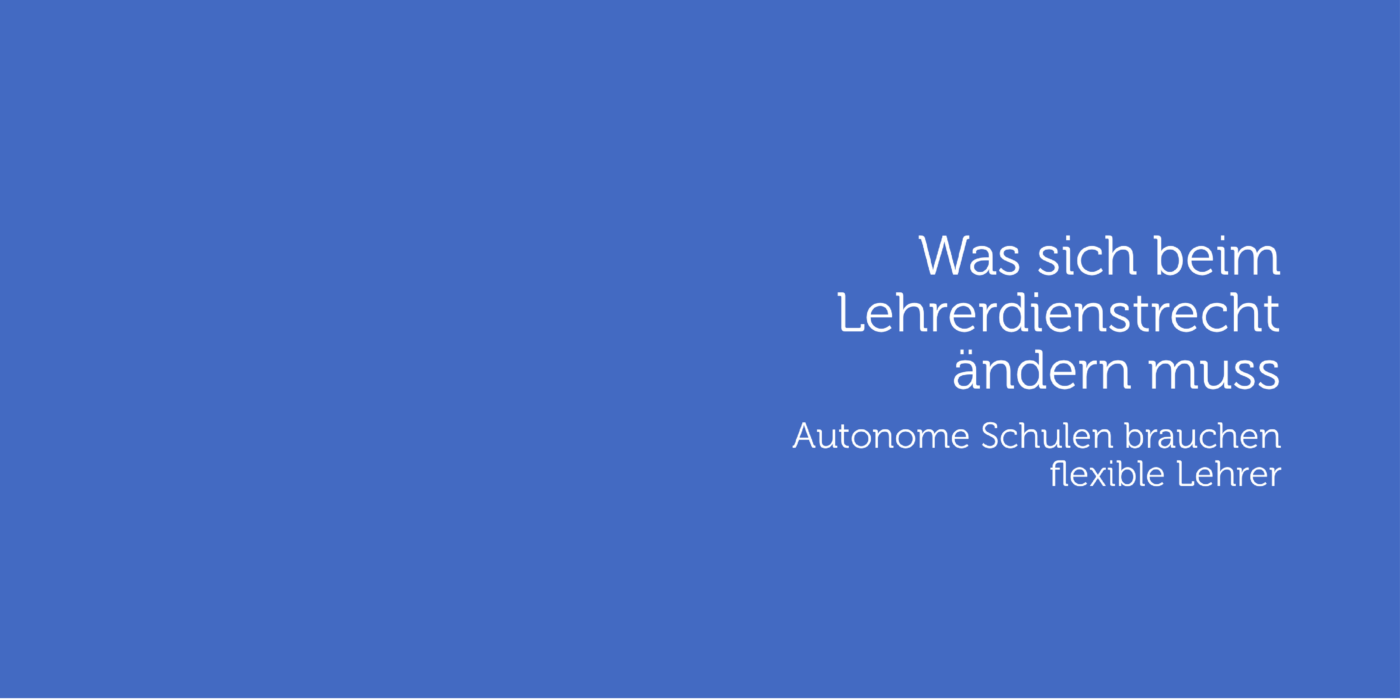
- 06.10.2015
- Lesezeit ca. 2 min
Autonome Schulen brauchen flexible Lehrer
Dienstrecht und flexible Unterrichtsgestaltung
Das neue Dienstrecht setzt die unzeitgemäße Definition der Lehrerarbeit über die Unterrichtsverpflichtung ungebrochen fort. Im Zentrum des „Arbeitsvertrags“ steht die Anzahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden. Jede – auch temporäre – Erhöhung der Unterrichtszeit muss als Mehrdienstleistung abgegolten werden. Aus dieser Logik folgt in umgekehrter Sichtweise, dass jede Aufgabe außerhalb des Vorbereitens und Abhaltens von Unterricht (z.B. Elterngespräche) zu einer Reduktion der Unterrichtszeit führen muss. Wie sollte eine neue, an der Schule autonom organisierte Form der Zusammenarbeit, eine stärker an die individuellen Bedürfnisse der Schüler angepasste Pädagogik oder eine Festlegung der Unterrichtszeit angepasst an die Bedürfnisse des Standortes mit dem überregulierten bestehenden Dienstrecht funktionieren? Wie viel an finanzieller oder personeller Autonomie kann an die Schule verlagert werden, solange das Dienstrecht ein enges Korsett bildet, das jede Innovation erstickt?
Dienstrecht und Verantwortung am Schulstandort
Das neue Dienstrecht versucht wie bisher alle anfallenden Arbeiten von Lehrern zu erfassen, zu kategorisieren und den Aufwand zu regeln. Das führt dann zu detailreichen Auflistungen von „standortbezogenen“ Tätigkeiten oder „individuell organisierten“ Tätigkeiten und zum bemerkenswerten Versuch, den jeweiligen Aufwand auch noch für Teilzeitbeschäftigte zu quantifizieren.[1] Das Lehrerdienstrecht behält damit den Charakter eines „Schutzgesetzes“ dessen unausgesprochene Aufgabe es ist, den Lehrer gleichsam vor den Zumutungen der modernen Lehrerarbeitswelt zu schützen. Es privilegiert rechtliche Normen als Basis der täglichen Zusammenarbeit, und verhindert, dass sich an den Schulen kooperative und motivierende Arbeitsbeziehungen entwickeln, die der jeweiligen spezifischen Situation entsprechen. Kein moderner Dienstleistungsbetrieb könnte unter solchen Bedingungen erfolgreich sein und wenn die anspruchsvollen Aufgaben an den Schulen dennoch mehr oder weniger gut gelöst werden, dann geschieht dies wohl trotz und nicht wegen der dienstrechtlichen Bestimmungen.
Dienstrecht und berufliche Weiterbildung
Die Verpflichtung zur Weiterbildung im neuen Dienstrecht ist bei näherer Betrachtung nicht mehr als eine Alibihandlung. Neben einer sehr allgemein gehaltenen Bestimmung über die Verpflichtung zur Weitereinwicklung der Kompetenzen findet sich lediglich die Formulierung, dass auf „Anordnung“ Fortbildungsveranstaltungen bis zum Ausmaß von 15 Stunden pro Schuljahr in der unterrichtsfreien Zeit zu besuchen sind. Das ist nicht nur vom Stundenausmaß viel zu wenig, es ist weit entfernt von einer dynamischen Schule, die den sich rasch verändernden Anforderungen mit permanenter Bereitschaft zur Weiterbildung entspricht. Die vorgesehene Verschränkung von Berufseinstieg (nach dem Bachelor) und begleitender Weiterbildung (Masterstudium) soll kurioserweise nur bis 2029 gelten. Und es ist derzeit fraglich, ob sie überhaupt realisiert wird.
Dienstrecht und Leistungsprinzip
Dem neuen Dienstrecht mangelt es fast vollständig an leistungsorientierten Komponenten. Vor allem ist die regelmäßige Gehaltsvorrückung weder an erfolgten Weiterbildungsaktivitäten noch an angemessenen Formen der Leistungsüberprüfung gekoppelt. Qualitativ hochwertiger Unterricht, aktives Engagement am Schulstandort und hohe Bereitschaft zu Weiterbildung werden gehaltsmäßig kaum honoriert. Der „faule“ Kollege steigt im selben Ausmaß die Gehaltsleiter hinauf. Das demotiviert und bremst auf lange Sicht jede Initiative.
Der Zeitplan zur Einführung des neuen Dienstrechts
Die beschlossene Regelung zum Inkrafttreten des neuen Dienstrechts besagt: bis ins Schuljahr 2018/19, also vier Jahre lang, können Junglehrer zwischen altem und neuem Dienstrecht wählen. Dabei wäre die Situation für einen qualitativen Umbruch gerade jetzt bestens geeignet. Bis zum Jahr 2020 wird voraussichtlich ein Drittel der österreichischen Lehrer in Pension gehen, bis zum Jahr 2025 sogar bis zu 50 Prozent! Das bedeutet einen gravierenden Generationenumbruch bei der Lehrerschaft, ideal geeignet um mit einer neuen Lehrergeneration eine moderne und reformorientierte Schule aufzubauen. Die lange Wahlmöglichkeit für das alte Dienstrecht dreht die Gunst der Stunde jedoch in ihr Gegenteil. Je nachdem welcher Anteil an Junglehrern sich in den nächsten Jahren für das alte System entscheidet, muss für die nächsten 40 bis 50 Jahre mit einer Parallelführung von zwei Dienstrechten geplant werden. Abgesehen von der bürokratischen Komplizierung ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Schulen noch 20 bis 30 Jahre lang vom alten Dienstrecht dominiert werden.
Fazit: Das Lehrerdienstrecht erlaubt nur eine Schein-Autonomie. Es muss grundlegend reformiert werden.
Das neue Dienstrecht (und natürlich auch die bestehenden alten) bildet einen Schutzwall gegen Reformen, dessen Barrieren nicht mehr als eine Schein-Autonomie der Schule zulassen würden. Es ist mit dem, was international unter moderner Schulautonomie verstanden wird, schlicht nicht vereinbar. Eine Weiterentwicklung und neuerliche Reform des „Arbeitsvertrags“ für Lehrer ist daher unumgänglich. Die Gespräche dazu sollten so bald wie möglich aufgenommen werden. Diesmal sollte es eine grundlegende Reform sein.
Fußnoten
- „(16) Bei der teilbeschäftigten Vertragslehrperson entspricht eine Wochenstunde der Unterrichtsverpflichtung 4,545% der Vollbeschäftigung. An die Stelle der weiteren zwei zu erbringenden Wochenstunden (Abs.3 dritter Satz) tritt die dem Anteil des Beschäftigungsausmaßes an der Vollbeschäftigung entsprechende Zahl von Wochenstunden. Beauftragungen mit Aufgaben gemäß Abs. 3 Z 1 bis 3 dürfen nur bei einem Beschäftigungsausmaß von mindestens 50% erfolgen. Je Wochenstunde der Unterrichtsverpflichtung sind im Verlauf des Unterrichtsjahres 3,273 Stunden an Beratungstätigkeit zu erbringen.“ Vertragsbedienstetengesetz 1948 in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2013. ↩
Mehr interessante Themen
Wenn der Föderalismus baden geht.
Über Gemeindefinanzen und Prioritäten.
Österreichs Gemeinden kommen mit ihrem Geld nicht mehr aus. Mal wieder. Eine Überraschung ist das nicht. Denn der österreichische Föderalismus ist eine Fehlkonstruktion.
Lohnverhandlungen: Wie Österreich zum kranken Mann Europas wurde.
Die österreichischen Löhne eilen davon. Aus der Rezession kommen wir aber nur heraus, wenn auch die Privathaushalte anfangen, sich an den Kosten der Misere zu beteiligen. Hoffentlich ist es dafür nicht schon zu spät.
Was er sagen müsste. Wenn er dürfte. Oder wollte.
Die Budgetrede, die das Land braucht – die Finanzminister Markus Marterbauer aber so nie halten wird.
Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.
Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö
Aller guten Dinge sind drei?
Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b
Der schnellste Weg aus der Budgetkrise
Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah





