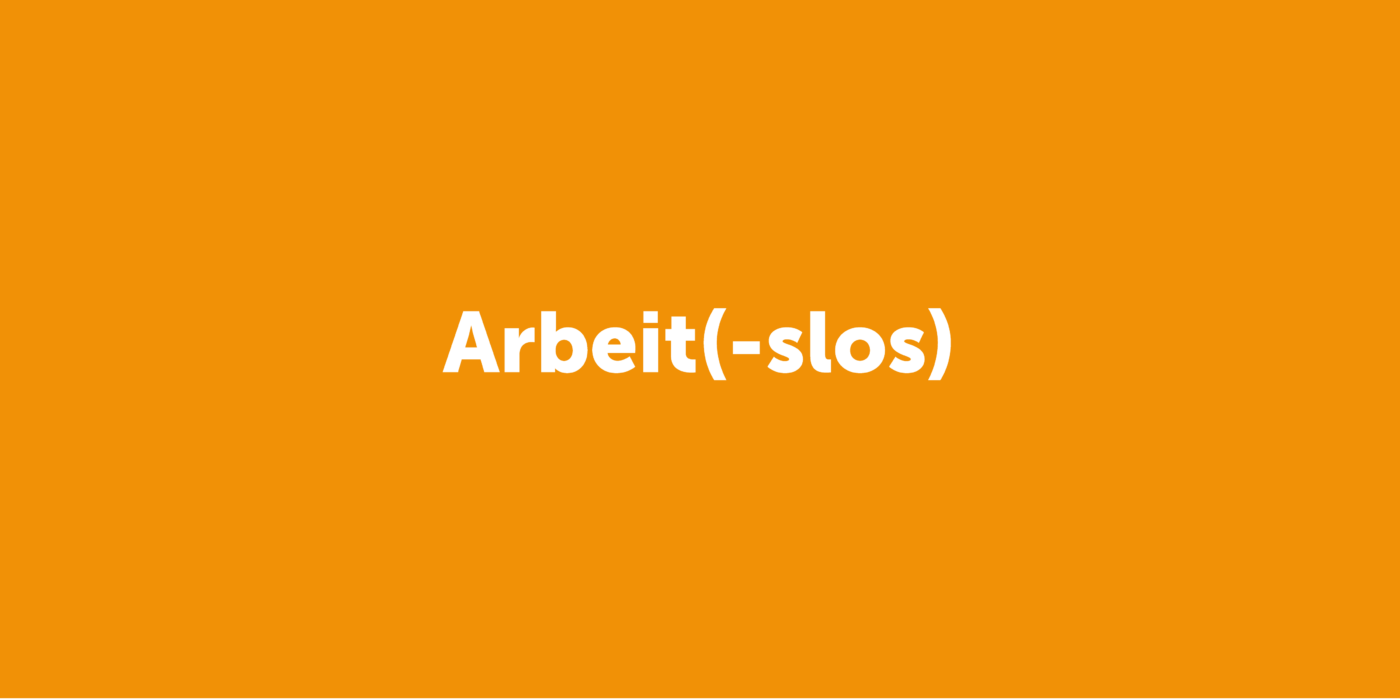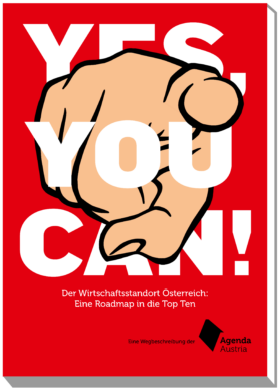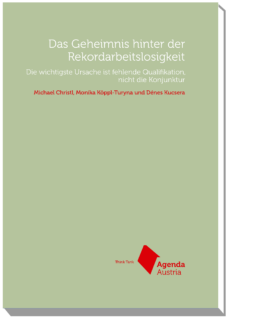Standortranking: Handlungsbedarf am Arbeitsmarkt
- 24.05.2018
- Lesezeit ca. 3 min
Österreich gewinnt im aktuellen Ranking des Schweizer IMD zwar an Boden, wird aber vor allem durch die Politik von den Top 10 ferngehalten.
Von 63 untersuchten Ländern liegt Österreich in puncto Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 18, so das Ranking 2018 der renommierten Schweizer Wirtschaftshochschule IMD (International Institute for Management Development). 2017 lag Österreich noch auf Platz 25. Auch dank der verbesserten Konjunktur hat das Land sieben Plätze gutgemacht, liegt aber immer noch im bescheidenden Mittelfeld. „Österreich hat eigentlich beste Voraussetzungen für einen Platz unter den Top 10. Dieses Ziel sollte sich die Regierung setzen“, sagt Agenda Austria-Ökonom Hanno Lorenz.
IMD-Gesamtranking: Wie wettbewerbsfähig ist Österreich?
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Quelle: IMD World Competitiveness Yearbook.
In der Gruppe der zehn besten Standorte finden sich vergleichbare Länder wie Schweden, Dänemark, die Niederlande und die Schweiz, dazu finden Sie hier eine interaktive Darstellung. Einen konkreten Maßnahmenkatalog für den Weg in die Top 10 gibt es hier nachzulesen.
Wie sich der Standort Österreich in den letzten zehn Jahren im Detail verändert hat, finden Sie hier. Auffallend: In den wichtigsten staatlichen Aufgabenbereichen ist Österreich weiter zurückgefallen, geradezu verheerend ist Platz 60 in der Steuerpolitik. Nur Griechenland, Belgien und Frankeich schneiden in dieser Kategorie schlechter ab als Österreich.
Probleme am Arbeitsmarkt
Alarmierend ist auch der Abstieg im Bereich Beschäftigung. 2008 lag Österreich hier noch auf Rang 19, mittlerweile ist man auf Platz 38 zurückgefallen, wie folgende Grafik zeigt:
IMD-Ranking: Wie attraktiv ist Österreichs Arbeitsmarkt?
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Quelle: IMD World Competitiveness Yearbook.
Der Grund für diesen Rückfall ist vor allem in der strukturellen Arbeitslosigkeit zu sehen. Diese liegt vor, wenn die von den Unternehmen angebotenen Stellen nicht zu den Qualifikationen und Fähigkeiten der Arbeitslosen passen. Als Konsequenz bleiben viele Stellen unbesetzt, aber die Arbeitssuchenden trotzdem arbeitslos.
Strukturelle Arbeitslosigkeit bekämpfen
Hinzu kommt die seit Jahren ansteigende Langzeitarbeitslosigkeit. Um Anreize zu schaffen, tritt die Agenda Austria dafür ein, zu Beginn der Arbeitslosigkeit ein höheres Arbeitslosengeld zu bezahlen, das im weiteren Verlauf schrittweise gesenkt werden soll. Das würde auf den ersten Blick mehr Geld kosten, weil Menschen, die nur kurz arbeitslos sind, mehr Geld erhielten. „Reformen in anderen Ländern haben jedoch gezeigt, dass Arbeitslose schneller einen Job aufnehmen und somit die Kosten sogar sinken könnten“, sagt Wolfgang Nagl, Ökonom der Agenda Austria. Der Vorschlag der Agenda Austria sieht zudem eine Berücksichtigung der Beitragsjahre vor: Jene, die länger in das System einbezahlt haben, sollen auch über einen längeren Zeitraum Leistungen beziehen können.
Um der strukturellen Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, muss die Ausbildung verbessert werden. „Es zeigt sich, dass gerade weniger gut qualifizierte Menschen Probleme am Arbeitsmarkt haben. Daher muss frühzeitig in die Ausbildung junger Menschen investiert werden“, so Nagl. Diese sollte beispielsweise schon durch eine gute Kinderbetreuung im frühkindlichen Alter begonnen werden.
Mehr interessante Themen
Yes, you can!
Der Wirtschaftsstandort Österreich: Eine Roadmap in die Top Ten
Damit sich die heimische Wirtschaft international bewähren kann und auf diese Weise der Sozialstaat finanzierbar bleibt, muss Österreich den Übergang von einer sicherheitsorientierten zu einer innovationsfreundlichen Politik schaffen. Unsere Volkswirte und Bildungsexperten haben hierzu einen leicht nachvollziehbaren Maßnahmenkatalog ausgearbeit
AMS: Es ist endlich Zeit für Neues
Das AMS steht seit Wochen in der Kritik. Die Agenda Austria fordert eine Reform des Arbeitslosengeldes.
Das Geheimnis hinter der Rekordarbeitslosigkeit
Die wichtigste Ursache ist die fehlende Qualifikation, nicht die Konjunktur
Die steigenden Arbeitslosenzahlen zeigen es: Österreich ist endgültig dabei, seine positive Ausnahmestellung innerhalb der EU zu verlieren. Warum aber ist die Zahl der Arbeitssuchenden so gestiegen? In diesem Paper zeigen die Autoren, dass immer mehr Menschen deswegen keinen neuen Job finden, weil sie die dafür nötige Ausbildung nicht mitbringe
Arbeitslos trotz Hochkonjunktur
Österreichs Wirtschaft befindet sich im Aufschwung. Das Wachstum ist so hoch wie lange nicht mehr. Dennoch kann die gute Konjunktur die Arbeitslosigkeit nicht entscheidend senken. Inklusive Schulungen liegt die Arbeitslosenrate bereinigt um saisonale Schwankungen weiterhin bei hohen 10,2 Prozent. Ausschlaggebend dafür sind strukturelle Probleme.